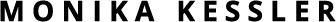Ady Endre
(1877 – 1919)
Es wäre nicht übertrieben zu sagen: Wenn es Ady nicht gäbe, müßte man ihn erfinden. Es wäre nicht … es ist bereits geschehen (man braucht keine Namen zu nennen, jedermann kennt sie sowieso). Denn alles ist umsonst, Ady ist doch in erster Linie der Ady der ungarischen Gedichte, der Poet der revolutionslosen ungarischen Revolutionäre. Beklagenswert grotesk ist dieses Publikum von Endre Ady.
Es besteht aus Menschen, die das Gefühl haben, daß es keine andere Abhilfe gibt als die Revolution. Die der Ansicht sind, daß das, was ist, niemals neu und gut war, sondern immer alles Neue und Gute verschlang; ein Übel, an dem man nichts bessern könne, das man vernichten müsse, um für neue Möglichkeiten Platz zu schaffen. Daß eine Revolution nötig sei, doch daß man nicht einmal von ferne die Möglichkeit eines Versuchs erhoffen könne. Sie wären nur Anführer; Menschen, welche – vielleicht – durch eine nur in den Träumen existierende Revolution und ein nachrevolutionäres Ungarn zu großen Persönlichkeiten werden könnten.
Und in allem ist es so. Überall sind die Ungarn die „allermodernsten”. Und beklagenswert grotesk stehen sie am radikalsten an der Spitze jeder neuen künstlerischen oder philosophischen Richtung; je redlicher und ungarischer sie sind, desto mehr. Denn es gibt keine ungarische Kultur, an die man anknüpfen könnte und da die alte europäische in dieser Hinsicht nichts bedeutet,kann nur die ferne Zukunft für sie die erträumte Gemeinschaft bringen. So ist auch die Lage der russischen Intellektuellen, doch haben diese wenigstens eine Revolution und so haben sie etwas, worin sie für ihre Sehnsucht nach Kultur eine Form finden können und diese „Erfüllung” gibt auch allen ihren nicht direkt sozialen und politischen Schöpfungen Form und Gewicht. Die Sehnsüchte der Ungarn müssen indes für ewig fruchtlos bleiben. Denn in Ungarn ist die Revolution nur ein Seelenzustand, die einzige positive formale Möglichkeit, daß die durch die unendliche Isolation verursachte Verzweiflung auch nur zum Ausdruck gelangen kann. Nur ein Seelenzustand, nur Sehnsucht, und zwar so sehr und so ausschließliche, daß dem in der Wirklichkeit nichts entspricht und sogar in der Vorstellung nichts wirklich Greifbares darin zu finden ist, nichts was an eine, wenn auch utopistische, Realität anknüpfen könnte.
Dieser Welt eines der Revolution beraubten Revolutionarismus entspringen die ungarischen Gedichte Adys. Schon in einem seiner früheren Gedichte („Vision auf dem Moor” in den „Neuen Gedichten”) erhält dieses Gefühl einen reinen Ausdruck: er, Endre Ady, der ungarische Mensch von heute, braucht die Revolution. Er braucht sie, denn ihre Zeit ist gekommen, nicht weil sie nützlich wäre, weil sie neue Werte bringen und alten Schund vernichten würde, sondern deswegen, weil er sie braucht, damit er weiterleben kann, damit er seine wurzellose Liebe irgendwo verpflanzen kann, damit er die Reichtümer, die in ihm zu Grunde gehen, irgend jemandem und irgendwohin weitergeben kann. Sein Leben muß irgendwo eine Form finden.
„Hält uns noch lang im schweren Banne
Das altvererbte Unglück nieder?
Du säumig-träge, rote Sonne,
Dich ruf ich wieder.
Ich will von Zorn erfüllt nicht sterben,
Verharrend mit gespanntem Bogen,
Mein hoffnungsloses Herz vom schwarzen
Geschick betrogen.
Geh auf, erscheine, rote Sonne…”
(Übersetzung von Zoltán Franyó)
Das ist das Verhältnis von Endre Ady (und von allen ungarischen Intellektuellen) zum Proletariat: die allerflüchtigsten, allerfeigsten, allerleisesten und kaum bewusst zu machenden Sehnsüchte gewinnen eine noch konkretere, noch greifbarere Form. Wenn ein Gorkij zum Sozialisten wird: eine große Sehnsucht vollendet sich; wenn ein Shaw (oder ein Anatole France – Ergänzung aus Huszadik Század) das tut: so zieht ein Denker alle Konsequenzen aus seimer Gesellschaftsphilosophie. Der Sozialismus des Endre Ady ist Religion (bei geringeren lediglich ein Narkotikum; ein gellendes Wort in der Öde, der Hilfeschrei eines Ertrinkenden, das krampfhafte Sich-Klammern an die einzige Möglichkeit, die es noch gibt, indem man diese nur anbetet (und manchmal auch verflucht); während man sie als unbekannt, geheimnisvoll und doch nah, dennoch als das einig Reelle empfindet.
„Eure Nacken drücken wilde Herren,
Euer Kopf ist dennoch stolz erhoben.
Frisch im Blut und groß in eurem Glauben,
Seit ihr Götter auf Máté Csáks Boden:
Vorwärts, vorwärts, Ungarns Proletarier!”
(Übersetzung von Heinz Kahlau)
Es ist fruchtlos, davon zu reden, in welchem Verhältnis Ady zum Sozialismus steht; der Sozialismus ist hier bloße Form, in der seine Gefühle eine Form finden. Wenn diesen revolutionären Liedern im Stil etwas verwandt ist, so sind das die Blasphemien Baudelaires oder die Mariengedichte von Verlaine und am meisten vielleicht Brentanos katholische Litaneien. Man braucht sich gar nicht auf Gedichte berufen, in denen Religion und Revolution verschmelzen (z.B. Die Posaune Gottes), oder nur für diejenigen, die den Namen Gottes sehen müssen, um in einer Sache das Religiöse zu erkennen; jedes Gedicht von Ady ist religiös. Wenn ich ganz kurz formulieren wollte, was allen zutiefst gemein ist, so müßte ich sagen: es sind religiöse Gedichte, das Ausströmen eines großen, mystischen, religiösen Gefühls nach allen Seiten und überallhin. Hier befindet sich eine derartig starke religiöse Potenz, ein derartig starker Wunsch nach der Religion, daß in der Welt dieser Gedichte alles zur Mythologie, jede Äußerung des Lebens zum Gott oder Teufel wird, zum Psalm jedes Gedicht, das darüber geschrieben wurde. (Und auch hier stehen uns – als überflüssige Dokumente – seine Worte zur Verfügung: „Ungeratene Bergreden sind alle meine Lieder”).
Das ganze Leben wird in den Gedichten Adys zur Mythologie. Eine ganz neue ungarische Mythologie ist bereits auch in seinen ungarischen Gedichten entstanden. In der weiten Ferne ist Paris das Verlockende, das Wunderbare, die Mutter aller Dinge, die neue Insel der Hesperiden, und in der Nähe ist das Ungarische Brachland, der Kreis und die Höhle des Fegefeuers und des Infernos, welche viele, ausgewählte Qualen hervorbringen. Und eine Kraft, die furchterregende Schatten wirft, erhalten hier Pusztaszer und Dévény, Máté Csák und die Stadt Debrecen. Der Kampf gegen sie beginnt; der alte Kampf der Kurutzen, der einige Kampf der György Dózsa, und die ermordeten Sellen der Vazul und der heiligen Margareten weinen die Begleitung zu dem großen Gefecht.
Und die noch größeren, noch tieferen: der Mythos des Erzkujons, und der des Fürsten Ond und vieler anderer. Man muß sich mit keinem Schritt aus dieser Welt belegen, und da sind die Hymnen des Gottes Baal, die Litaneien des Gottes Geld, die geheimnisvollen Legenden des Prinzen Stille aus dem Komitat Bihar, die Elegien des Sommers und der große Rundtanz um die Goldstatue der Leda. Und einen nur offenen, nur gänzlich reinen Ausdruck erhielt dieses immer bestehende Gefühl in den neuesten Gedichten, den Gott-Gedichten, ohne jede Zwischenstation, unter Weglassung jedes „Erlebnisses” und jedes „Symbols”.
Endre Ady – ein Mystiker. Was ist der Sinn dieses Ausdrucks? Vielleicht dieser: der Mystiker (ich lege nur die Gefühlsform und nicht deren Äußerungen zugrunde) hat keine Distanzprobleme. Also gibt es für den Mystiker keine Widersprüche, es gibt keine Unterschiede zwischen den „Anschauungen”; er ist ein für alle Mal alles und auch das Gegenteil von allem. Das heißt: für den Mystiker gibt es keine großen und keine kleinen Dinge, für ihn gibt es nichts Heiliges und nichts Profanes, es gibt keine „Realitäten” und keine Träume und es gibt nicht jene Unterscheidungen, die wir zwischen dem Konkreten und dem Abstrakten, dem Subjektiven und dem Objektiven zu treffen pflegen. Das war im Mittelalter recht einfach und recht leicht zu durchschauen: der Mystiker war derjenige, in dem alles zur Religion wurde, oder vielleicht besser: in dem die Religion, die Essenz der Religion zu allem wurde. Doch dies ist heute genauso einfach, wenn auch nicht so leicht zu durchschauen, und der ganze Unterschied zwischen einem alten und einem heutigen Mystiker ist nur der, daß der alte über Formen verfügte und der heutige nicht. Dem alten gaben die Kirche, der offizielle Glauben und die Bibel sichere und unerschütterliche Formen, Formen, zwischen deren feste Mauern sich die heißen Lava-Bäche der Ekstasen getrost ergießen konnten. Der heutige Mystiker hat nichts, wo er eine Form finden könnte, er muß selbst, aus sich selbst heraus, alles erschaffen: Gott und den Teufel, die Erde und das Jenseits, den Erlöser und den Antichristen, die Heiligen und die Verdammten; er selbst muß die Bibel schreiben und all das, um dessentwillen er sie dann lesen würde. So verliert er bei aller Identität des Wesentlichen die Reinheit des Typen: es scheint bloße Dichtung zu sein. Denn für das oberflächliche Sehen gibt es keinen Unterschied zwischen dem dichterischen „Motiv” oder „Gegenstand” und der mystischen Lebensexegese; was damals beides ganz klar voneinander trennte, der Spielcharakter des einen und das positive Wesen des anderen, ist heute bereits verschwunden und die Mystik existiert heute nur noch als Gefühlsform überall und nach allen Seiten verstreut. Jeder echte Dichter ist so heutzutage mehr oder weniger Mystiker, viel mehr und viel stärker als im Mittelalter; vielleicht deswegen, weil heute der Großteil der Mystiker – gezwungenermaßen – zu Dichtern wird.
Versuchen wir nun von dieser Seite aus den Stil Adys zu bestimmen. Vielleicht wäre dies am einfachsten mit Hilfe der Extreme möglich. Ich würde sagen: Adys Lyrik ist die am reinsten begriffliche Lyrik, und: Adys Lyrik ist die allersinnlichste von allen. Und zusammenfassend: in Adys Lyrik gibt es keinen Unterschied zwischen nah und fern. Nicht in dem Sinn, als sei das künstlerische Problem des Distanzierens gelöst, als seien nah und fern artistisch ausgeglichen (das ist in jedem guten Gedicht so), sondern ganz wortwörtlich. So, daß es keinen Unterschied zwischen nah und fern, konkret und abstrakt, Ich und der Welt, Erlebnis und Symbol gibt (und diese Reihe von Parallelen könnte man bis ins Unendliche fortsetzen). Adys Gedichte sind kaum mehr persönlich. Nicht vor unseren Augen wächst ein Erlebnis zum Symbol, zur Unendlichkeit, zum Alles-in-sich-Vereinen, sondern es wirkt irgendwie so, als würden die beiden äußersten Pole, das, was am tiefsten Grunde der Dinge und der Seele schlummert, was bei beiden verdeckt wird durch das, was wir Individualität oder Stimmung, oder auch Augenblicklichkeit zu nennen pflegen, es scheint also, als würden nur diese extremen Punkte existieren und mit solcher Vehemenz aufeinanderprallen, als würde das Feuer ihrer Einswerdung sie zu einer untrennbaren Einheit verschmelzen. Die Sinnlichkeit der Bilder Adys ist geradezu schmerzlich stark und unmittelbar, doch das, was in ihnen zum Bild wird, ist mit der kühlsten Sicherheit und der treffendsten Abstraktheit begrifflich, feststellend, über alles nur Individuelle weit inausgegangen. Nur ein paar Beispiele schreibe ich an diese Stelle:
„Solch ein Schmerz ist keinem aufgebürdet
auf diesem Erdenrund,
nur dem Ungarn, der aus der Art schlägt”,
oder:
„Ich fühle Gottgeruch und suchte
dort einen, der mir längst entwich.”
oder „Die Beine stampften bis zum Knie
Im Blute einst und siehe:
Ich habe keine Beine mehr,
Nur Knie noch, nur Knie.”
( Übersetzungen von Zoltán Franyó)
Jedes Ady-Gedicht beleuchtet mit blitzschneller Präzision eine Situation und drückt sie mit endgültiger Kraft aus; das wichtigste Geheimnis der Wirkung liegt vielleicht in jener auf keine andere Art und Weise erreichbaren gewichtigen und dichten Präzision, mit der eine Definition (leider gibt es kein anderes Wort dafür) jeweils alles umfaßt. Ich denke vor allem an solches:
„Böse ist hier die Welt: das trotzige Hunnien
Erficht träumend die alte Schlacht.
ES schlägt die Zukunft…”
Vielleicht ist es so: In den Ady-Gedichten wird jede Frage zur metaphysischen Frage, jede Stimme kommt irgendwo aus dem Jenseits, von jenseits der Dinge; aus je empfindlicherer, schmerzlicherer Nähe sie erklingt, umso stärker. Deshalb kann sein dichterisches Sehen mythenschöpfend sein: denn seine Symbole leben mit der greifbarsten sinnlichen Kraft und sind doch aus solchen Tiefen erfaßt, so „allgemein”, daß nichts individuelles, keine auch im besten Sinne handwerklich vollkommene Gestaltung in ihnen ihre Spuren hinterläßt. Selbst die wildesten Phantasien wirken, als wären sie irgendwo der Erde entwachsen, ohne Ursprung, ohne Ahnen, ohne Schöpfer.
Wir sagten: Adys Gedichte sind geradezu unpersönlich, obgleich kaum tiefere und reinere Bekenntnisse geschrieben wurden als diese; und dennoch könnte man mit ihrer Hilfe kein „imaginary portrait” Adys zeichnen. Ady ist alles und das Gegenteil von allem; seine Lyrik ist die Verewigung jeder Stimmung. Die Gesamtheit seiner Gedichte wirkt, als wäre seine Seele nur ein großer Spiegel, in dem sich alles mit vollkommener Schönheit und Tiefe spiegelt, in dem sich aber alles das spiegelt, was die Augenblicke bringen. Ady ist ein Mystiker und für den Mystiker gibt es keinen Unterschied zwischen den großen und den kleinen Dingen, zwischen dem Moment und der Ewigkeit, nicht einmal so viel, daß das eine die Emanation des anderen sein könnte” Man könnte aus diesen Gedichten alles herauslesen, doch zugleich auch das Gegenteil von allem und von jedem Blickwinkel. Für den Mystiker ist alles in gleicher Weise groß und nur die Religion war es, die den alten eine Form gegeben hatte; der heutige Mystiker hat nur Augenblicke, die Offenbarungen des heutigen bestehen aus dem Nebeneinander von Millionen einzelnen, in sich vollendeten, einander Widersprechenden Stimmungs-Atomen. Nur als solche Gedichte können sie eine Form erhalten, doch einem Mystiker kann es niemals genügen, wenn er ein paar oder gar eine ganze Reihe „schöner” Gedichte geschrieben hat. Hier liegt die Bedeutung der ungarischen Gedichte für Ady selbst: in ihnen finden seine mystischen Sehnsüchte zum ersten Mal eine Form, eine über Gedichte und ästhetische Wirkungen hinausgehende Bedeutung; sie reichen bis zum Leben, sie wachsen in es hinein, sie formen es, kneten es um und erschaffen es von neuem; Tausende finden Worte für ihre noch nicht einmal zum Stottern gediehenen Klagen und Schmerzen, sie bieten den Gottessuchern Gebetbücher und rütteln mit Kampfespsalmen diejenigen aus ihren Träumen wach, die seit Jahrhunderten schlummern. Ady brauchte die ungarischen Gedichte, um nicht nur Poet zu sein, denn er hätte als Poet das Leben niemals ertragen, denn für ihn hätte es nicht zur Form werden können, ein Dichter zu sein, dessen Gedichte von feinen Händen umtastet werden als seien sie schlanke Vasen, oder dessen leise Worte schamhaft Beseelte in stillen Kammern flüstern, um auch vor sich selbst zu verbergen, was sie fühlen.
„Sie schauen mich an und alles ist in Ordnung:
„Der ist ein Großer oder Niemand.”
Nur keiner fragt das eine:
Muß man ihn hassen oder lieben?
Behandelt werde ich wie ein Säugling,
Zum Schlafe hier gebracht, dort aufgerüttelt.
Wozu bin ich geboren: zu sein jemand,
Prophet zu sein oder elender Hund?”
Hier trifft sich das zentrale Erlebnis Adys mit dem zentralen Erlebnis seiner Leser. Denn es ist gewiß: dies ist seine wirkliche Bedeutung für das heutige Ungarn; das Gewissen, das Kampfeslied, die Posaune, die Fahne zu sein, worum sich alles gruppieren kann, wenn einmal gekämpft wird, das Kennwort, das die abends am Lagerfeuer Wachenden einander geben. Aber man könnte gewissermaßen sagen: diese Wirkung Adys ist zufällig, denn bei ihm sind die ungarischen Gedichte doch nur Episoden; seine Seele spiegelt alles gleich und mit der gleichen Kraft wider. So spiegelt sie auch dies, dies, gerade das, was wir Ungarn so sehr, in so unersetzbarer Tiefe brauchen. Das müßten wir sagen, wenn wir Ady nur als Dichter betrachteten; wenn wir sein abnormal intensives, tiefes und spontanes Einfühlungsvermögen als typisch dichterisch, als harfenartig ansehen würden, so als könne jeder Wind sie gleichermaßen erklingen lassen. In den ungarischen Gedichten bläst der Wind nur von einer Seite, und es gibt nur eine Möglichkeit, ihr Gegenteil gibt es nicht. Hier sind die Rollen im voraus und für alle Ewigkeit verteilt, mit strenger Ausschließlichkeit ist das Gute vom Bösen getrennt, mit harter, greller, plakathaft scharfer Färbung ist das eine blendend weiß, das andere strahlend schwarz gemalt. Es ist wahr: der alte Mystiker macht keine Unterschiede, weil der Glaube sie für ihn macht; Ady muß hier den Rahmen für sich selbst schaffen und innerhalb dessen entwickelt sich dann alles so wie überall sonst.
Alles das war ein Versprechen von wunderbarem Reichtum und Farbenpracht und war zum Teil auch in den alten Bänden vorhanden; doch den reinsten Stil fand er dennoch im Neuen. Die Sprache Endre Adys wird immer klingender einfach, großzügiger und umfassender; nachdem er in ein paar Gedichten des Bandes „Blut und Gold” den Gipfel an „Interessantheit”, an farbenfrohem Schillern erreichte, fängt er jetzt mit immer einfacheren, wenigen und großen Flecken an zu arbeiten; näher jener zum Einfachen hin führenden Entwicklung, an der die besten der heutigen Maler und ein paar sehr große Dichter (Kipling, Verhaeren, Stefan George usw.) arbeiten. Er verliert dadurch nichs von seiner sinnlichen Kraft. Aber wenn auch sein Feuer heftiger ist als es war, so ist es jetzt gebremster. Wenn seine Farben auch strahlender sind als die alten, so sind sie doch in stärkere Kompositionen mit strengerer Kraft eingefaßt. In den Gott-Gedichten wird dieses Gefühl am meisten sublimiert, in der handgreiflichen Ausschließlichkeit der Metaphysik, in den Worten, die nur äußerste Gefühle, nur das Innehalten an den äußersten Punkten ausdrücken, und mit felssturzartiger Gewichtigkeit dahinrollen. Adys Lyrik wird in einem schönen und großen, dem einzig richtigen Sinne, immer primitiver. Von jeder Sehnsucht, jedem Gedanken, jedem Sehen fällt immer stärker alles Zufällige, alles Begleitende, alles Impressionistische ab, und mit der ausschließlichen und großartigen Monotonie einiger weniger großer Gefühle wogen die Ströme der letzten Gedichte dahin. Früher war jedes Gedicht eine Landschaft oder ein Mensch oder eine großartige Situation, heute ist jedes nur eins große, einfache, alles umfassende, großzügige Geste.
So steht der dreißigjährige Ady in der heutigen ungarischen Lyrik als einer der Jüngsten unter den Jungen. Irgend einmal machte er den ersten großen Aufruhr in der ungarischen Lyrik, indem er den nach ihm Kommenden Farben und Klänge gab und Mut, Möglichkeiten und Wege zum Neuen, Mutigen, Bunten und Interessanten. Heute ist er an dem Punkt angelangt, die neue Wandlung zu vollziehen: den Kampf gegen das „Interessante”, das, was heute erst in der bildenden Kunst bewußt geworden ist, wogegen sich die offizielle „neue” ungarische Literatur am heftigsten wehren würde und sich auch wehren wird, welche sich nur bei ein paar ganz jungen Schriftstellern meist kaum bewußt zu Wort zu melden beginnt, und was sich erst in ein paar Jahren (wenn überhaupt) dort mit ganzer Kraft offenbaren wird.
So steht der dreißigjährige Endre Ady als der am stärksten, am sichersten von allen in die Zukunft weisende ungarische Schriftsteller da. Seine – zutiefst – ganz zeitlose Lyrik ist sowohl in ihren sozialen Wirkungen die einzig bedeutende, als auch die menschlich am tiefsten erschütternde und formal am erregendsten aktuelle heutige ungarische Dichtung.
Quelle:Esztétikai kultúra (1912) S. 45-54.
Georg Lukács
Endre Ady …
Aus dem Ungarischen von Agnes Meller
Kontrolle von Júlia Bendl
Gedichte:
Lauschst du meinem kranken Herzen (Beteg szívemet hallgatod…)
Solang man lebt, leben ( Élni, míg élünk…)
Niemandem Ahn (Sem utódja…)
Am Ufer der Theiß ( A Tisza parton)
Lauschst du meinem kranken Herzen …
Dich suchend noch auf seinem Weg, im Kampfe,
Wie tapfer doch und kraftvoll war mein Herz,
Wie klang so rein sein Tönen, und so hell.
Wie ist es nun so krank und abgeschunden:
Nichts mehr erhält es noch am Weiterschlagen,
Als einzig deiner Liebe großes Wollen.
Wenn ungestüm und wild aufklänge
Von Qual und Wonne noch einmal sein Lied,
Sein Lied – es wär das deine, das es sänge.
Ein Lied, daß ich dich doch gefunden habe,
Nach Schuld und Irrweg, groß und weit,
Doch lebend noch, und nicht im Grabe.
Und alles wär erfüllt, hätt’ eine Stund’
Nur seine Weise es gesungen neben dir
Und nicht zum Fluch geöffnet ich den Mund.
Mit krankem Herzen, du göttliches Wesen,
So eng dir verbunden, bekenne ich hier
In inbrünstig sehnender, trauriger Liebe:
Höre nicht auf sein böses, krankes Beben,
Mein Herz ist gut, weil du darinnen
Soll’n unsere Herzen diese Stunden durchleben …
(Bekenntnis der Liebe – Übertr. v. A. W. Tüting)
Élni, míg élünk …
Igen: élni, míg élünk,
Igen: ez a szabály.
De mit csináljunk az életünkkel,
Ha fáj?
Igen: nagyot akarjunk,
Igen: forrjon agyad,
Holott tudjuk, hogy milyen kicsinység
A Nagy.
Igen: élj türelemmel,
Igen: hallgass, ha fáj.
Várd meg, hogy jöjjön a nagy professzor:
Halál.
Igen: élni, míg élünk,
Igen: ez a szabály.
De mit csináljunk az életünkkel,
Ha fáj?
(A Magyarság Titkai)
Solang man lebt, leben …
Ja: solang man lebt, leben,
Ja: diese Regel nur zählt.
Doch was sollen wir tun mit dem Leben,
Wenn es uns quält?
Ja: Großes erstreben,
Ja: mit feurigem Geist,
Und gleichwohl wissen, wie bedeutungslos klein
Das Große doch ist.
Ja: lebe geduldig,
Ja: verschweig deine Not.
Wart nur, daß er komme, der große Professor
Tod.
Ja: solang man lebt, leben,
Ja: diese Regel nur zählt.
Doch was soll’n wir tun mit dem Leben,
Wenn es uns quält?
(Geheimnisse des Ungarntums – Übertr. v. A. W. Tüting)
Sem utódja …
Sem utódja, sem boldog ôse,
Sem rokona, sem ismerôse,
Nem vagyok senkinek,
Nem vagyok senkinek.
Vagyok, mint minden ember: fenség,
Észak-fok, titok, idegenség,
Lidérces, messze fény,
Lidérces, messze fény.
De jaj, nem tudok így maradni,
Szeretném magam megmutatni,
Hogy látva lássanak,
Hogy látva lássanak.
Ezért minden: önkínzás, ének:
Szeretném, hogyha szeretnének,
S lennék valakié,
Lennék valakié.
„Szeretném, ha szeretnének”
Niemandem Ahn …
Niemandem Ahn, niemandem Erbe,
Niemandem anverwandt, bekannt, und sterbe…
Bin jemand – keinem,
Bin jemand – keinem.
Bin doch, wie jeder andere: Hoheit,
Nordkap, Geheimnis, Fremdheit, Soheit,
Irrlichternd, ferner Schein,
Irrlichternd, ferner Schein.
Doch ach, kann weiter so nicht bleiben,
Würde mich andern gerne zeigen,
Dass sie mich wirklich sähen,
Dass sie mich wirklich sähen.
Dafür all dies: Selbstqual, mein Singen,
Könnt’ man mir Liebe doch entgegenbringen,
Und ich wär’ jemandes,
Ich wäre jemandes.
(Könnt man mich lieben doch – Übertr. v. A. W. Tüting)
A Tisza-parton …
Jöttem a Ganges-partjairól,
Hol álmodoztam déli verõn,
A szivem egy nagy harang-virág,
S finom remegések: az erõm.
Gémes kút, malom alja, fokos,
Sivatag, lárma, durva kezek,
Vad csókok, bambák, álom-bakók,
A Tizsa-parton mit keresek?
„Új versek ”
Am Ufer der Theiß …
Ich kam von den Ufern des Ganges,
Wo ich gedöst in der Mittagsglut,
Mein Herz, groß: eine Glockenblume,
Und ihr feines Zittern: mein Mut.
Ziehbrunnen, Mühlgrund und Beil,
Wüste, Lärm, grobe Hand,
Wilde Küsse, Narren, Traum-Henker,
Was nur such’ ich am Tisza-Strand?.
(Neue Gedichte – Übertr. v. A. W. Tüting)