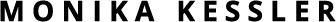Gemüsehändler und Arier
Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten mehrten sich in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Schwierigkeiten der ungarischen Diplomaten in Berlin. Sie versuchten, ihre konservativen, jedoch rechtsstaatlichen Normen bei den Behörden des Dritten Reichs wenigstens auf konsularischem Gebiet durchzusetzen.
Berlin, Juli 1933. Die ungarische Staatsbürgerin Therese Steiner wendet sich in einem Schreiben mit der Bitte um Beihilfe an das Königliche Ungarische Konsulat. Die Direktion der städtischen Markthallenverwaltung, Friedrichstraße 35, habe zum 31. Juli 1933 ihren Verkaufsstand gekündigt, klagte sie. Die Behörde begründete die Maßnahme damit, dass Steiner und ihr Ehemann nicht arischer Abstammung seien. Die seit 1913 in Berlin ansässige ungarisch-jüdische Familie fürchtet um ihre Existenz.
Das ungarische Konsulat reagiert umgehend, schickt eine Verbalnote an das Auswärtige Amt, die Beamten in der Wilhelmstraße zeigen jedoch keinen all zu großen Enthusiasmus, in der Angelegenheit zu intervenieren. Am 10. August 1933 schreibt die Frau wieder an die Gesandtschaft und teilt mit, dass die Kündigung nicht rückgängig gemacht wurde.
Ihr sei bekannt geworden, dass die polnischen, tschechoslowakischen und englischen Staatsangehörigen, denen ebenfalls gekündigt worden war, von der Direktion der Städtischen Zentralmarkthalle eine bessere Behandlung erfuhren. Die seitens der Direktion ausgesprochenen Kündigungen wurden in ihren Fällen bedingungslos mit der Begründung zurückgenommen, dass sie ausländische Staatsangehörige seien. „Ich habe mich durch den Einblick in die Originalpapiere davon überzeugt”, schreibt sie. Der zweite Versuch der ungarischen Vertretung erwies sich als erfolgreich und die Familie Steiner durfte den Berlinern ihre Waren wieder feilbieten.
Gleichschaltung der Ungarn
Ähnliches drohte der Obst- und Gemüseimportfirma der Gebrüder Fuchs in der Kaiser-Wilhelmstraße 16/17. Die ungarischen Diplomaten, die vermutlich einen Musterbrief für solche Beschwerden parat hatten, mussten nur den Absatz der Argumentation variieren. In diesem Falle hieß es: „Schließlich möchte die Königlich-Ungarische Gesandtschaft noch hervorheben, dass die Firma Gebrüder Fuchs den Hauptteil der ungarischen Obstimporte auf dem Berliner Platz aufnimmt. Der jährliche Umsatz dieser Firma beträgt ihren Angaben nach 250 bis 400 Waggons. Eine Behinderung ihrer freien Handelstätigkeit würde daher die ungarischen Handelsinteressen auf das Empfindlichste schädigen.”
Szilárd von Masirevich, der ungarische Gesandte, stattete am 14. Juli 1933 Gerhard Köpke, dem Abteilungsleiter des Außenministeriums des Deutschen Reiches, einen persönlichen Besuch ab. Masirevich, der schon seit 1909 im diplomatischen Dienst stand, überreichte seinem Gesprächspartner eine Verbalnote zum Fall „Gebrüder Fuchs”. Bezüglich der Kündigung der Obsthändler brachte Köpke in seiner, noch auf den gleichen Tag datierten Aufzeichnung, folgende Gedanken zum Ausdruck: „Beim Abschluss des deutsch-ungarischen Handelsvertrags 1931 sei eine unterschiedliche Behandlung der reichsdeutschen Staatsangehörigen, wie sie seit der Machtübernahme durch das Kabinett Hitler vorgesehen sei, nicht in Frage gekommen. Die damaligen Vereinbarungen seien also unter der stillschweigenden Voraussetzung einer Gleichschaltung der in Deutschland ansässigen Ungarn mit allen deutschen Staatsangehörigen abgeschlossen worden. Es sei selbstverständlich, dass die Juden fremder Staatsangehörigkeit bei Handhabung der gesetzlichen Bestimmungen über die Nichtarier nicht besser gestellt werden könnten als die deutschen Staatsangehörigen jüdischen Glaubens.” Ähnlich wie im Fall Steiner, wurde die Angelegenheit wegen der ungarischen Staatsangehörigkeit, die wohl schwerer wog, zu Gunsten der Gebrüder entschieden.
Berlin, Sommer 1934. Karl Faragó lebte seit zwanzig Jahren in Berlin, verfügte über eine gültige Aufenthaltsgenehmigung, vergaß aber seinen ungarischen Reisepass zu verlängern. Das Berliner Polizeipräsidium befahl daraufhin, ihn aus dem Deutschen Reich auszuweisen. Faragó war Kriegsveteran – er kämpfte ähnlich wie die Gebrüder Fuchs im ersten Weltkrieg als Honvédartillerist an der Front und war stolzer Besitzer von Kriegsauszeichnungen wegen Tapferkeit vor dem Feinde. In Deutschland hatte er als Administrationsleiter des Laboratoriums des Erfinders Dénes von Mihály gearbeitet.
Der von der Ausweisung bedrohte Faragó wandte sich am 15. Juli 1934 an die Ungarische Gesandtschaft. In jenem bestimmten Absatz der Verbalnote argumentieren die ungarischen Beamten, dass „Herr Dénes Mihály hieramts wiederholt vorgesprochen und erklärt hat, das die Mitarbeit des Herrn Faragó für ihn unentbehrlich sei”. In Folge des Wirkens des Auswärtigen Amtes prüfte der Polizeipräsident den Fall nochmals und setzte die Durchführung der verfügten Ausweisung auf drei Jahre aus. Aus den erhaltenen Dokumenten geht nicht hervor, ob Faragó nach Ablauf dieser Frist seine Wahlheimat verlassen musste, oder ob das inzwischen ausgetauschte Personal der Ungarischen Gesandtschaft unter Döme Sztójay am Vorabend des Weltkriegs wieder ihre Stimme für einen Landsmann erhoben hat.
Ein ähnlicher Schicksalsschlag waren die Verordnungen des Reiches für Aron Schwarz, der in Berlin-Weißensee lebte. Er war von 1921 bis 1931 in der Schwerindustrie tätig, musste aber infolge einer schweren Lungenerkrankung seine Arbeit beenden. Er bezog eine Invalidenrente in Höhe von 30 Reichsmark pro Monat. Im Juli 1934 wurde ihm die Auszahlung verweigert und das Rentenbuch abgenommen, weil er kein Arier sei. Im Bescheid der Reichsbetriebsgemeinschaft Eisen und Metall hieß es, dass seine „weiteren Ansprüche als abgegolten zu betrachten” seien. Die Ungarische Gesandtschaft intervenierte, und die Deutsche Arbeitsfront, das Amt für Selbsthilfe, setze Aron Schwarz ab Januar 1935 wieder auf die Liste der Unterstützungsberechtigten.
Ein Attentat
Ludwig von Norman, Delegierter des Königlichen Ungarischen Außenhandelsamtes, war am 10. Mai 1934 mit seiner Frau im eigenen Wagen nach Berlin-Erkner unterwegs, als 15 bis 20 unbekannte Männer das Auto aufhielten. Einer von ihnen sprang auf die Stoßstange, klopfte mit einem Stock gegen die Windschutzscheibe und forderte den Fahrer schreiend auf, die Straße umgehend zu verlassen. Normans Frau sprang aus dem Wagen, schimpfte wegen „solcher Leute, welche die meisten Unfälle verursachen” und forderte die Angreifer auf, den Weg frei zu machen.
Der Gruppenführer – ließt man in der Aufzeichnung von Norman – trug einen Ring mit SS-Insignien. Er griff die Frau an und zerriss dabei den rechten Ärmel ihres Mantels. Als Norman auch das Auto verließ, gingen die Männer auf ihn los und verprügelten ihn. Dabei beschimpften sie ihn als „verfluchten Hund” und „lästigen Ausländer”.
Nachdem die Vorbeifahrenden die Polizei benachrichtigt hatten, stellte sich heraus, dass zwei der Täter im Reichstagsbüro angestellt waren. Dem ersten Verhör folgte das zweite. Inzwischen versuchten einige der Verdächtigen, telefonisch den ungarischen Diplomaten dazu zu bringen, die Angelegenheit „friedlich zu erledigen”. Der ungarische Gesandte Masirevich beschäftigte sich schließlich persönlich mit dem Fall Norman. Er sorgte dafür, wie es im Brief an das Auswärtige Amt heißt, dass „das Vorkommnis nicht in die Presse gebracht” wird. Er hoffe, dass „dieser peinliche Zwischenfall seine Sühne finde”.
Weitere Reichsbehörden bekamen umgehend die Abschriften der Beschwerde über den Zwischenfall, auch das Preußische Ministerium des Innern, die Reichskanzlei und nicht zuletzt die NSDAP. Die Ermittlungen gegen die Attentäter liefen parallel: Zum 22. Juli 1934 waren zwei Attentäter, diejenigen, die im Reichtagsgebäude beschäftigt waren, entlassen worden. Einen Monat später befasste sich das zuständige Amtsgericht mit dem Fall, stellte aber im November 1934 das „Strafverfahren auf Grund des Gesetzes über Straffreiheit” ein.
Damals hatten die deutschen Behörden noch bestimmte Formen des diplomatischen Kodex zu beachten, um dem international schlechten Image des Regimes nicht weiter zu schaden. Es gab jedoch tatsächliche Interessensunterschiede zwischen den beiden Staaten. Budapest befürchtete in Zusammenhang mit Görings Besuch von Belgrad, dass das Reich allzu gute Beziehungen zu den Intimfeinden Jugoslawien und Rumänien pflegen wollte. Den Beamten des Auswärtigen Amts war der Gesandte Masirevich mit seinen „typischen langen Fragelisten” besonders lästig, und sie wünschten sich dessen baldige Abberufung.
Bis 1938 gelang es den ungarischen Diplomaten, den in Deutschland lebenden ungarische Staatsbürgern unabhängig von ihrer konfessionellen Zugehörigkeit Rechtsbeistand zu leisten. Die Zahl der eingereichten Beschwerden und Verbalnoten ist ebensowenig festzustellen, wie jene der damals in Deutschland lebenden Ungarn. Im Berliner Staatsarchiv sind Dutzende von Fällen zu finden, die meisten stammen jedoch aus den Jahren 1933 bis 1935.
Im Jahre 1938 änderte sich die Lage im gesamten Reichsgebiet schlagartig. Leiter verschiedener Ortsgruppen der Gestapo, insbesondere österreichische nach dem Anschluss im März, benachrichtigten die ungarischen diplomatischen Vertretungen darüber, dass die „Behörden sich nicht mehr in der Lage sehen, die persönliche und materielle Sicherheit der hier lebenden ungarischen Staatsangehörigen jüdischer Rasse” zu garantieren.
Gleichzeitig informierte auch die ungarische Regierung ihre Diplomaten, dass „gegen eine solche Behandlung ungarischer Staatsangehöriger” zu protestieren ein „ungewöhnliches Verhalten zwischen zwei befreundeten Nationen” darstelle. Der Einsatz ungarischer Diplomaten für ihre Landsleuten war in Ungarn selbst nie gern gesehen. Das Budapester Parlament verabschiedete im Mai 1938 das erste und im Mai 1939 das zweite Judengesetz. Rechtsstaatliche Bedenken spielten in den beiden Ländern keine Rolle mehr.