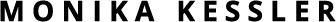Schätze der Ungarischen Dichtkunst
Schätze der Ungarischen Dichtkunst
SÁNDOR PETŐFI
1823-1849
„Petőfi ist der ungarische Dichter, den man in allen Ländern kennt. Er ist der ungarische Liebling der Götter. Ihm gaben sie alles, damit er ein großer Dichter werde, Talent, Historie, Schicksal. Er lebte sechsundzwanzig Jahre und ließ ein Lebenswerk von Weltmaßstab zurück. Überdies erhielt er, was außer ihm vielleicht nur Byron zuteil wurde: den zum Symbol erhebenden, mythisch verklären- den, das Werk für alle Zeiten beglaubigenden Tod. Der Dichter der Freiheit und der Liebe, des Glaubens an das Leben fiel auf dem Schlachtfeld als Kämpfer für die Freiheit. Genie und Dichterschicksal, die hehrste Vision der Romantiker, fanden in ihm ihre Ver- körperung.
Petőfi kam – als die Zeit dafür reif war – und er kam dorthin, wo der Dichter der Volksstimme, der Dichter der Revolution hinkommen mußte.” [1]
Einige biographische Daten: Geboren wurde er in der Ortschaft Kiskőrös, mitten in der Ungarischen Tiefebene, von Eltern, die den slawischen Namen Petrovics führten. Der Vater war vollwertiger Ungar, die Mutter, Maria Hruz, eine frühere Dienstmagd, legte erst allmählich die slowakische Muttersprache ab. István Petrovics war Schlächter, Gastwirt und Pächtcr, der Wert darauf legte, daß sein Erstgeborener lerne und in den höheren Stand der Intelligenz aufsteige. Er ließ ihn in mehrere Schulen gehen, solange er es erschwingen konnte. Später hatte er mit seinen Geschäften Unglück, und mußte auch dulden, daß sein Sohn von der Schulbank zum Theater weglief. Nicht viel später meldete sich der mittellose Siebzehnjährige zum Militär. Dem schweren Dienst nicht gewachsen, wurde er nach zwei Jahren entlassen, ging wieder zur Schule, dann wieder zu den Schauspielern, und durchwanderte das Land. Inzwischen dichtete er, schrieb Lieder im Volkston, von denen das eine und andere in einer Zeitschrift gedruckt wurde. Nach einem krank durchlittenen und durchhungerten Winter in Debrecen (Stadt in Ostungarn) wanderte er nach Pest – mit einem Packen Gedichte im Ranzen. Er lieh sich einen Anzug, in diesem stellte er sich dem großen Dichter Vörösmarty vor. Dem gefielen seine Gedichte, er brachte eine Buchausgabe zustande und verhalf Petőfi zu einer Anstellung als Hilfsredakteur bei einer Zeitschrift. In kurzer Zeit wurde Petőfi im ganzen Land bekannt – als Dichter. Die ersten Erfolge kamen daher, daß Petőfi einen neuen Ton anschlug, einen volkstümlichen, den jeder verstand, und der jeden ansprach – sehr zum Ärger der konservativen Kritik.
Hier bietet es sich von selbst an, dem Biographischen etwas Literarhistorik beizumischen. Im Volkston hatte Petőfi bereits Vorgänger: Csokonai, Kölcsey u. a., doch zur Vollendung brachte er den sogenannten volkstümlichen Stil. Nicht zu vergessen ist der intimste Dichterfreund, János Arany, der das gleiche vollbrachte – und doch wie anders! War Petőfis Sprache eine plebejisch- bäurische? Ja, das war sie, aber keine triviale, sondern eine gesäuberte, gesiebte Volksprache, die allerdings nichts von ihrem Ursprung, dem Völkischen, preisgab, mit der er sich aber vollständig von der „gehobenen” Sprache der Romantiker abwandte. Er handhabte die Volkssprache frei von jeder Herablassung, jeder Affektation, fügte ihr aber etwas Undefinierbares hinzu, eben das Einmalige, das jeder Zeile, jeder Strophe, jeder Metapher von Petőfi eigen ist. Bei ihm ist die Dichtkunst keine Errungenschaft, sondern eine Selbstverständlichkeit. Was er sieht, was ihm einfällt, was er wahrnimmt, verwandelt sich im gleichen Augenblick in ein Gedicht, und eben diese Spontaneität, diese Selbstverständlichkeit wirkt unwiderstehlich. Sicher hat Petőfi eine Wandlung, durchgemacht, eine Steigerung in den sechs bis sieben Jahren, die ihm als Dichter gegeben waren, vom Simplen zum Vielschichtigen, Komplizierten durchgemacht (das oft als Stagnation angesehene Jahr 1846 war eher eine Pause zur Verinnerlichung), aber die Unmittelbarkeit des Ausdrucks hat er auch dann beibehalten, und wenn die Wirkung, die er ausübte und noch heute ausübt, ein Geheimnis birgt, so ist das, dieses je ne sais quoi sein Geheimnis, und das konnte ihm kein anderer ablauschen und nachmachen – trotz der zahllosen Petőfi-Epigonen. Inzwischen erwarb er sich eine erstaunliche Bildung; nun kamen zu den Liedern Genrebilder, Situationslyrik hinzu (Mutters Henne, Am Dorfrand) und die zahllosen Liebesgedichte von den sentimentalen Etelka-Trauerliedern (1845) über viele Gelegenheitsliebschaften bis zu den großen schwärmerischen Ergüssen an Julia Szendrey, die seine Frau wurde. (So wie der Zweig erzittert, Der Herbstwind fiüstert mit den Bäumen, ein bravuröses Revolutionsgedicht über ein Liebes-Kontinuo: Wie könnte ich dich nennen? und der geradezu metaphysisch erhöhte September-Ausklang.) Genauso reich sind die beschreibenden Gedichte, zu denen getrost solche lyrisch durchsetzten wie Ein Abend daheim, Auf dem Ochsenwagen hinzugezählt werden können wie die eindeutigen Landschaftsbilder, die ja auch immer mehrdeutig sind, Winter, Die Theiß, Winterabend, die Pußta im Winter.
Petőfi war, wie erwähnt, ein Sohn des ungarischen Tieflandes und hing mit Leib und Seele an diesem „alföld”. Er hat unglaublich viel dazu beigetragen, daß diese Gegend als die ungarischste bekannt und ihre Schönheiten erkannt wurden. Man lese z. B.: In meiner Heimat, Kleinkumanien, Tiefland im reicheren Auswahlband der Petőfi-Gedichte in der deutschen Corvina-Ausgabe.
In allen diesen Gedichten spiegelt sich der Reifeprozeß, den der jünglinghafte Dichter zum Mann durchmachte, und immer klarer tritt die Erkenntnis des Zeitgeschehens zutage, die Freiheitsidee, mit einer Spannweite vom bürgerlichen Radikalismus bis zur Revolution. Petőfi war ja in erster Linie ein politischer Dichter, und als solcher ist er am besten bekannt. Der aufgeklärte Patriot entwickelte sich zum Revolutionär, der konsequent den Weg von der linken Mitte bis zur äußersten Linken ging, und überzeugter Republikaner wurde. Schon der Dreiundzwanzigjährige schrieb Ein Angsttraum quält mich, das ein Bekenntnis zur „Weltfreiheit” war. Bald aber reifte die revolutionäre Situation heran, zu der gerade Petőfi anregend beitrug und dann auch Führer der Pester revolutionären Jugend wurde. Mit seinem Nationallied hat er dem Tag der Revolution, dem 15. März 1848, ein unvergängliches Denkmal gesetzt. (Er hat es an dem Tag vor der begeisterten Menge deklamiert und mußte es mehrere Male wiederholen.) Während der Revolution folgten Gedichte wie Leben oder Tod, Hängt die Fürsten auf u. a. m. bis in das Jahr 1849 hinein, als der anfangs erfolgreiche Freiheitskampf infolge der Einmischung einer russischen Armee zusammenbrechen mußte. (Europa schweigt und das letzte Gedicht, das Major Petőfi im Feld schrieb: Zeit des Entsetzens.)
Um auch einen heitereren Ton anzuschlagen, seien zu den politischen Gedichten zwei groteske, früher geschriebene hinzugezählt, zwei Charakterbilder: Der ungarische Edelmann und Herr Pál Pató, vernichtende und doch nicht gehässige Porträts ungarischer Edelleute. (Gehässig war der liebenswerte Petőfi nur selten, zum Beispiel: Hängt die Fürsten (Könige) auf, ein Gedicht, das ihm selbst seine Anhänger als zu radikal übelgenommen haben.) Sonst ist er immer humorvoll, menschlich (Die Ruinen der Csárda, das Hundelzratzloch, Die Tintenflasche) und vielleicht gehört eben das zu dem Charme, mit dem dieser Dichter immer bestrickt. (Hoffentlich auch in den treuen Nachdichtungen.)
Die kurze Einführung – kurz, weil die Auswahl so knapp bemessen ist – soll nicht abgeschlossen werden, ohne des Epikers Petőfi zu gedenken. Erwähnt seien das komische Epos Der Dorfharmmer und das Märchenepos Held János (heide 1844), in denen schon die klare, würzige, nichtfolkloristische Volkssprache da ist, die zwar später noch reicher, aber im Grunde unverändert bleiben sollte.
Als drittes episches Werk sei noch Der Apostel erwähnt, ein im Revolutionsjahr, 1848, entstandenes, politisch kühnes, romantisches und konsequent revolutionäres Poem mit viel Schönheiten im Einzelnen.
Außerdem dichtete Petőfi auch Prosa (einen Roman, ein Drama, übersetzte Shakespeare u. a. m.). Da sind seine Reisebilder, die Tagebuchaufzeichnungen, bestrickend wie jede Zeile, die er schrieb, auch dann, wenn er sich in die Höhen einer Gedankenlyrik erhebt. (Das Gericht, Die Dichter des 19. Jahrhunderts, Licht.)
Vieles könnte noch hinzugefügt, überdacht und analysiert werden, was in diesem Sechsundzwanzigjährigen steckte und was er uns noch hätte geben können. Aber auch so steht fest, daß Petőfi zu den größten lyrischen Genies seines Landes – und nicht nur seines Landes – gehört.
Géza Engl
Gedichte
Auswahl
DIE DEUTSCHEN NACHDICHTUNGEN SIND VON
MARTIN REMANÉ
MIT AUSNAHME DER GEDICHTE:
„LEBEN ODER TOD” UND „IN DEN BERGEN”,
DIE GÉZA ENGL ÜBERTRUG.
EINLEITUNG VON GÉZA ENGL
AUSGEWÄHLT VON
ISTVÁN KERÉKGYÁRTÓ
Ungarn – Magyarország – Hungary
Artikel aus dem Neuen Pester Lloyd
Die Revolution „wittere ich, wie ein Hund das Erdbeben”
Ein Nachruf zum 150. Todestag von Sándor Petöfi
Von László F. Földényi

• Sándor Petöfi (01.01.1823 – 31.07.1849)
• Daguerrotypie von 1847
Keiner wollte glauben, daß er mit fünfundzwanzigeinhalb Jahren gestorben ist. Umsonst beteuerten die Zeugen, daß sie gesehen hätten, wie der unbewaffnete Dichter auf dem Schlachtfeld von Segesvár von russischen Lanzern erstochen wurde; man konnte sich nicht mit dem Gedanken abfinden, ihn verloren zu haben. Legenden begannen sich um ihn zu ranken. Bald sah man ihn verkleidet auf einem abgelegenen Gehöft auftauchen, bald erkannte man ihn in einem wandernden Bettler. Und als schließlich jede Hoffnung zerronnen war, erfand man für ihn das schrecklichste aller Schicksale: Petôfi läßt sich deshalb nicht blicken, weil er in einem Bleibergwerk im fernen Sibirien schmachtet. Diese Legende ließ sich nicht mehr widerlegen. Noch vor kurzem, in den 1990er Jahren, brach eine Expedition nach Sibirien auf, um sein Skelett aufzuspüren. Was man natürlich nicht fand. So ergeht es dem Toten der Nation. Er hat keine Leiche, weil er selbst überall gegenwärtig ist.
Keiner konnte sich damit abfinden, daß es Petôfi nicht mehr gab. Das ungarische Volk erwartete seine Rückkehr wie den Messias. Obwohl man auch ihm, wie dem echten Messias, kurz vor seinem Tod viel Unrecht zugefügt hat: man nannte ihn verrückt, wahnsinnig, verbreitete das Gerücht, er sei ein russischer Spion, ja verdächtigte ihn sogar, heimlich einen slowakischen König auf den ungarischen Thron setzen zu wollen – er, der wie kein zweiter jeden König am Galgen sehen wollte und Kaiser Franz Josef bei dessen Krönung mit einem der aufrührerischsten Gedichte der Weltliteratur grüßte, das den Titel trägt: „Hängt die Fürsten auf”. Warum er gerade mit einem slowakischen König verdächtigt wurde? Weil sein Vater, seine Mutter Slowaken waren. Und doch wurde er der größte aller ungarischen Dichter. Nicht erst nach seinem Tod, sondern schon zu Lebzeiten. Kein Dichter außer Byron war zu Lebzeiten in seiner Heimat so bekannt wie Petôfi: kaum war er zwanzig, als sein Bildnis schon das ganze Land schmückte, seine Bände immer neue Auflagen erreichten und schon zu Lebzeiten eine Straße nach ihm benannt wurde – noch heute gibt es kein Dorf und keine Stadt in Ungarn, in dem es nicht mindestens eine Petôfistraße gäbe -, und es gab keinen, der seine Dichtungen nicht gekannt hätte. Selbst die Analphabeten lallten seine Gedichte. Petôfi erlebte wiederholt, daß Gedichte, die er ein paar Monate zuvor verfaßt hatte, in den verschiedenen Landesteilen bereits als Volkslieder gesungen wurden.
Kein Wunder also, daß man die Nachricht seines Todes nicht geglaubt hat. Er war schon zu Lebzeiten eine Legende. Er galt nicht einfach als Dichter, sondern als Naturwunder. Die Laufbahn und das Leben des 1823 geborenen Dorfjungen sind märchenhaft: Wie der Märchenprinz brach auch er auf, um das Glück zu finden, aber nicht nur für sich, sondern für sein ganzes Volk. Er nannte sich eine „Feldblume der Natur”. Aber er war auch ein Komet, der in die damalige ungarische Literatur einbrach, bevor sich seine Schriftstellerkollegen überhaupt besinnen konnten, und schon als zwanzigjähriger Junge als der größte Dichter der Nation galt. Er wischte jede stillschweigende Übereinkunft beiseite, akzeptierte keine Regeln und erschütterte die zeitgenössische ungarische Literatur, die bis zu seiner Ankunft nie bis zu den tiefsten Schichten durchdringen konnte, in ihren Grundfesten.
Das Geheimnis von Petôfis unerhörter Beliebtheit bestand vor allem darin, daß er der erste war, der die Literatur im eigentlichen Sinn des Wortes volkstümlich machte. Nicht indem er sich zum Volk niederbeugte und in einer gekünstelten, idealisierten Volkssprache zu ihm plapperte – wie dies später ein Jahrhundert lang zahlreiche Petôfi-Epigonen taten -, sondern indem er das Volk emporhob. Er war der erste, der in den einfachen Menschen das Bewußtsein weckte, was es eigentlich bedeute, ein Volk zu sein. Was das Wort „Heimat” bedeute. Und damit verbunden, das Wort „Freiheit”. Denn er konnte beide nicht voneinander trennen. Als Nachfolger der englischen lake poets und der Lieddichter der deutschen Romantik führte auch Petôfi die einfache Alltagssprache, die von Schwulst befreite Ausdrucksweise in die ungarische Literatur ein. Aber im Gegensatz zu ihnen sah er – als Kind einer späteren Generation und Vorbote der 1848er Revolutionen – das Volk nicht nur als Mythos, als eine verschwommene und konturlose Masse, die den Blick des Dichters in die Vergangenheit schweifen läßt, sondern als eine gesellschaftliche Schicht, eine Klasse, einen politischen Faktor. Seine Empfänglichkeit für die volkstümliche Tradition verband er mit einer sozialen Sensibilität und ließ dadurch vor dem ungarischen Volk, das bis dahin nicht einmal für voll genommen wurde, Weiten aufblitzen, wie sie seitdem in Ungarn niemand mehr aufgezeigt hat.
Er war jedoch nicht nur sensibel für Soziales, sondern auch radikal. Sein Radikalismus erinnert in vielerlei Hinsicht an Shelley, den er las und schätzte; doch im Gegensatz zu Shelley blickte er nicht in platonische Höhen, sondern dachte auch als Dichter über konkrete politische Lösungen nach.
Vor allem wollte er den Abgrund zwischen der Nation und dem Volk überbrücken, ein Ziel, das seit den 1830er Jahren in ganz Europa auf der Tagesordnung stand, aber gerade in Ungarn mehr als in jedem anderen Land eine dringliche Aufgabe war. Ungarn vermißte schmerzlich die Voraussetzungen einer bürgerlichen Gesellschaft; das Land, das gemessen an Westeuropa schon damals großen Nachholbedarf hatte, war gekennzeichnet durch die feudale Gesellschaftsordnung. Auch vor Petôfi gab es Bemühungen, das Volk emporzuheben; ein guter Teil des ungarischen Adels war aufgeschlossen für Reformen und wollte das Volk als Verbündeten auf seiner Seite wissen – vor allem, um mit seiner Hilfe die Unabhängigkeit des Vaterlandes von den Habsburgern zu erringen.
Petôfi jedoch stellte sich auf die Seite des Volkes, indem er sich mit der gleichen Geste gegen die Aristokratie wandte. Den Begriff der Nation, der sich bis dahin auf den Adel beschränkte, dehnte er auch auf das Volk aus. Doch damit im Körper der Nation auch für das Volk Platz war, mußte man die Adeligen zurückdrängen. Oder gar hinausschaffen. In einem Brief schrieb Petôfi: „Wenn das Volk einmal in der Dichtung herrscht, ist es nicht mehr weit, bis es auch in der Politik herrscht, und das ist die Aufgabe des Jahrhunderts, das zu erringen das Ziel einer jeden edlen Brust, die es satt hat, mitanzusehen, wie Millionen als Märtyrer leben, damit einige Tausende dem Müßiggang und Genuß frönen können. Zum Himmel mit dem Volk, zur Hölle mit der Aristokratie!”
Kein Wunder, daß er eine ebenso beliebte wie gefürchtete Gestalt der ungarischen Literatur war. Die einfachen Menschen sahen einen Messias in ihm, der jedoch – gleich dem ursprünglichen Messias – nicht nur die Aussöhnung, sondern auch die Spaltung, den Kampf verkündete und die Bühne der ungarischen Literatur und des öffentlichen Lebens mit dem „Schwert der Zerstörung” betrat. Wie kein anderer Dichter der Zeit in Europa vermochte er das Volkstümliche mit dem Revolutionären zu verbinden, konnte er seine Empfänglichkeit für Nation und Vaterland mit dem gesellschaftlichen Radikalismus, dem Liberalismus vereinbaren. Er war ein Patriot, indem er zugleich durch und durch ein Kosmopolit war. Die ungarische Literatur und die ungarische, politische Kultur sind seitdem unfähig, diese natürliche Einheit zu verwirklichen – die Volkstümlichkeit und der soziale Radikalismus, der Patriotismus und der Liberalismus stehen sich bis zum heutigen Tag feindlich gegenüber. Petôfi war der erste ungarische Dichter, für den die Einheit der beiden natürlich war. Das machte ihn so einzigartig in der ungarischen Dichtung seiner Zeit – und deshalb konnte er der erste ungarische Dichter werden, den man nur am Maßstab der von Goethe verkündeten Weltliteratur messen kann.
In die Weltliteratur ging er über die Dichtung ein – doch seine Dichtung stellte er nicht in den Dienst der Weltliteratur, sondern der Weltrevolution. In dem Gedicht „Die Dichter des 19. Jahrhunderts”, einer ars poetica, sieht er die wichtigste Aufgabe des Dichters darin, das Volk nach Kana zu führen, so lange bis sich der uralte Menschheitstraum der vollkommenen Gleichheit vollendet hat.
• Erst dann, wenn jeder gleichberechtigt
• Platz nehmen darf am Tisch der Welt,
• erst dann, wenn jeder gleichermaßen
• sein Teil vom Überfluß erhält,
• wenn durch die Fenster aller Hütten
• das Licht der Bildung Einzug fand,
• erst dann ist’s Zeit für uns zu rasten,
• erreicht ist das Gelobte Land.
Was auffällt, ist: der wichtigste Vertreter der kommunistischen Idee in den Augen Petôfis, und darin erkennen wir ihn als würdigen Nachfolger Shelleys, ist nicht der Politiker, nicht der Berufsrevolutionär, sondern der Dichter. Der Dichter, schreibt er, ist eine „Fackel für den Weg”, den Gott der Menschheit vorangestellt hat. „So führt das Volk voran, ihr Dichter, / durch Feuer, Flut und Wüstensand!”, spricht er. Dieses 1847 verfaßte Gedicht ist eine Proklamation der Avantgardedichtung; es nimmt trotz des biblischen Tons und des Titels (Die Dichter des 19. Jahrhunderts) die Überzeugung der Dichtung der Avantgarde im 20. Jahrhundert vorweg. Petôfi war vor allem offen für die Idee der Revolution – „ich wittere sie, wie ein Hund das Erdbeben”, schrieb er -, doch konnte er sich keiner Bewegung anschließen. Er blieb eine autonome, souveräne Gestalt der ungarischen Politik und Dichtung, die sich während des ungarischen Freiheitskampfes von 1848/49 genauso gegen Kossuth wenden konnte, wenn es sein mußte, wie gegen die verhaßten Österreicher.
Am 15. März 1848, dem Tag der ungarischen Revolution, deklamierte das ganze Volk sein Gedicht, und dieses Gedicht, das Nationallied, das sofort in zahlreiche Sprachen, so auch ins Deutsche übertragen wurde, wurde mit einem Schlag das bekannteste Gedicht der ganzen ungarischen Literatur. Petôfis Radikalität konnten jedoch auch seine engsten Gesinnungsgenossen nicht folgen, und schon einen Monat später, im Mai 1848, begannen sie ihn zu ächten. Die Unerbittlichkeit, die aus seiner Dichtung strömte, ließ sich in der Welt der Politik in der Tat nicht lange aufrechterhalten. Sein an Saint-Just und Marat gemahnender Republikanismus war auch in der damaligen europäischen Literatur unbekannt; selbst Heine, der Petôfi so hochgeschätzt hat, war resignierter, bitterer, ironischer als er. Kein Wunder, daß das Gedächtnis der Nachwelt bemüht war, Petôfi die Tiefe zu nehmen, seine Gestalt ins Klischeehafte, ja Kitschige umzustilisieren.
Die späteren Generationen feierten ihn als den Dichter von Volksliedern, verheimlichten jedoch seine Radikalität; priesen seine Liebesdichtung, nahmen jedoch nicht zur Kenntnis, daß viele seiner Gedichte nicht salonfähig sind; sangen seine gemütvollen Weinlieder und verschwiegen seine anarchistischen, auch Haß verströmenden Gedanken.
Das konnte auch nicht anders sein in einem Land, das kaum zwei Jahrzehnte nach der Niederschlagung des Freiheitskampfes von 1848 mit seinen Bezwingern, den Österreichern, handelseinig wurde. Petôfi hat nie mit jemandem gehandelt. In der österreichisch-ungarischen Monarchie hat man den alten Franz Josef am Ende des 19. Jahrhunderts ausnahmslos geliebt, obwohl dieser den ungarischen Freiheitskampf von 1848/49 blutig niedergeschlagen hatte. Wer hätte sich da getraut, Petôfis anläßlich Franz Josefs Krönung verfaßte Ode „Hängt die Fürsten auf” laut vorzutragen, in der er mit einem solchen Haß über die gekrönten Häupter schreibt, wie es in der europäischen Literatur nur noch in einer anderen Ode zu finden war, in Heinrich von Kleists gegen Napoleon gerichteteter Dichtung Germania an ihre Kinder.
• Habt ihr noch nicht gelernt, daß Haß, nur Haß
• den Königen gebührt? Voll ist ihr Maß!
• Könnt ich verteilen meinen Haß an euch,
• der mir die Brust zersprengt, ich tät’s sogleich!
• Wer sich zu hassen scheut, zahlt ewig drauf!
• Zerschlagt die Throne, hängt die Fürsten auf!
• Verderbt sind sie, ihr Herz ist kalt und leer,
• schon niederträchtig von der Mutter her,
• ihr Lasterleben spricht dem Volke Hohn.
• Schwarz ist die Luft von ihrem Atem schon,
• noch aus dem Grab stinkt diese Pest herauf.
• Zerschlagt die Throne, hängt die Fürsten auf!
Aber nicht nur sein politischer Radikalismus wurde allmählich zum Tabu. Die Nachwelt wollte auch mit der Tatsache nicht konfrontiert werden, daß er, der Dichter der Gemeinschaft par excellence auch zutiefst einsam sein konnte. Seine Begeisterung war mindestens so mächtig wie sein Lebenshaß, ja seine Todessehnsucht, die ihn zum Nachfolger Novalis’, zum Zeitgenossen Baudelaires und Schopenhauers, ja zum Vorläufer Nietzsches werden ließ. Er war ein naiver Dichter im Schillerschen Sinne; doch fehlten auch die sentimentalen Züge bei ihm nicht. 1846 schrieb er sein Gedicht Mein Schicksal, schaff mir Raum, das mit den Worten beginnt:
• Mein Schicksal, gönne mir, sinnvoll zu leben,
• zu wirken für der Menschheit Wohl!
• Weh mir, wenn ungenutzt die reine Flamme,
• die in mir brennt, verlöschen soll!
Doch innerhalb einer Woche schrieb er auch sein Gedicht Welthaß, das er mit den Worten schloß:
• Verschiedne Wirkung hat der Gram auf uns,
• verblüffend komisch ist das oft sogar,
• verfinstern kann er ganz ein helles Herz
• und schneeweiß färben rabenschwarzes Haar.
Petôfi wäre jedoch nicht Petôfi gewesen, hätte er neben seiner Anbetung des Volkes, Freiheitsliebe und Verpflichtung für das Leben nicht auch seiner Lebensunlust, seinem Welthaß und seinen Ängsten kosmische Ausmaße verliehen. In seinem Gedicht Feentraum schrieb er:
• …Vielleicht hat sich die Erde
• verkleinert nur? Gewiß war: Ich empfand,
• daß alsogleich in ihrem wärmsten Teile,
• im Herzen, eine Leere auch entstand.
Diesen Gedanken erweitert er bald darauf in einem Vierzeiler so:
• Wenn sich ein solcher Sturm zusammenballte,
• Daß er den Himmel auseinanderrisse,
• Und diesen Erdball durch die Spalte
• Hinunter schmisse!
Die Gespaltenheit der Person ist für ihn genauso untrennbar verbunden mit der großen Gespaltenheit des Weltalls, wie er an anderer Stelle sein persönliches Glück nicht von Kana und der Weltfreiheit trennen kann. Oder hier ein anderer seiner Vierzeiler:
• Was droht mir denn? Was soll mit mir gescheh’n?
• wie fiel ich dieser Ahnung nur zum Raube?
• Mir zuckt das Herz in konusiv’schen Weh’n –
• Wie ein geköpftes Menschenhaupt im Staube.
Heine schrieb, daß Petôfi, zu seinem Glück und zum Glück seiner Nation, die Hamletschen Züge fehlten. Heine kannte jedoch nicht alle Gedichte Petôfis. In seinem Gedicht Licht schrieb auch Petôfi selbst, daß es für ihn nicht auf die Frage „Sein oder Nichtsein” ankäme, sondern ob der Mensch seinen Mitmenschen von Nutzen ist oder nicht. Dennoch mündet das Gedicht in den Nietzscheschen Gedanken der ewigen Wiederkunft und endet so:
• Geht unser Weg
• nicht ewig auf und ab?
• Entsetzlicher Gedanke!
• Wen er noch nicht befallen hat,
• den hat’s vor Kälte nie geschaudert,
• der weiß noch nicht, was frieren heißt.
• Ein warmer Sonnenstrahl
• scheint eine Schlange mir dagegen,
• die kalt wie ein Eiszapfen
• auf unsre Brust sich legt,
• um unsern Hals sich wendet und
• abschnürt den Atem in der Kehle…
Dieses Gedicht nimmt den Nietzscheschen Gedanken der kalten Räume vorweg. Vergessen wir nicht: Nietzsche hat mehrere Gedichte Petôfis vertont. Petôfis Gedanken des Welthasses tangieren jedoch auch die Gedanken Schopenhauers; und seine Angst atmenden Dichtungen stehen der Philosophie Kierkegaards nahe, der gerade 1844 sein Werk Der Begriff Angst schrieb.
Petôfi lebte mit jeder Nervenfaser in seiner Epoche. Er war nicht nur der große Lyriker der ganz Europa begeisternden Ideen der Revolution von 1848; auch der zeitgleich mit den revolutionären Gedanken auftretende, die moderne, europäische Literatur bestimmende, resignative Ton war ihm nicht fremd. Das Geheimnis seiner Größe besteht darin, daß er diese beiden Standpunkte niemals gegeneinander ausgespielt hat: er wurde genausowenig ein politischer Programmdichter wie ein Lyriker der Décadence. Er war einer jener seltenen Dichter des 19. Jahrhunderts, die ihr allerpersönlichstes Ich und ihr gemeinschaftliches Ich niemals voneinander getrennt haben. Ein gutes Beispiel dafür bietet eines seiner schönsten und beliebtesten Gedichte, Die Theiß, das vom liebsten Fluß der Ungarn handelt. Das Gedicht beginnt mit der Beschreibung des sanften, liebenswürdigen Flusses, der das Symbol ätherischer Ruhe und Zuverlässigkeit sowie des ungarischen Bodens ist. Doch am Ende des Gedichts entfesselt sich plötzlich der glatt dahinfließende, an einen Mutterschoß erinnernde Fluß und überflutet seine Dämme. Die letzten Zeilen des Gedichts lauten:
• Und schon wogte Wasser wie ein Meer,
• hatte schon die Dämme übersprungen,
• war schon übers Feld ins Dorf gedrungen!
• Rasend kam die Theißflut angerollt,
• als ob sie die Welt verschlingen wollt!
Die Theiß, seit jeher ein Symbol für Ungarns geographische, geistige, natürliche und seelische Einheit, ist für Petôfi sowohl ein „naiver” als auch ein „sentimentaler” Fluß. Zuverlässig und uferlos, berechenbar und furchterregend, liebenswürdig und hassenswert. Sie ist schön und erhaben, weckt idyllische Vorstellungen, löst aber auch Entsetzen aus. Sie ist urtümlich und modern. Wie auch Petôfis Dichtung. Wie sie nur einmal in einem Jahrhundert entsteht, wenn überhaupt. Und die deshalb auch rätselhaft und geheimnisvoll ist.
Niemals hat jemand Petôfis Begabung und Größe in Frage gestellt. Und dennoch müssen wir, wenn wir ehrlich sind, zugeben, daß Petôfi tot ist. Am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts ist eine so umfassende Verflechtung der privaten und der gemeinschaftlichen Sphäre wie sie seine Dichtung charakterisierte, nicht mehr nachvollziehbar. Wir preisen ihn, wir feiern ihn, doch insgeheim hüten wir uns vor ihm. Vielleicht entstanden nach seinem Tod deshalb so viele Legenden über ihn – mit einer in der Ferne heimatlos umherirrenden, im Nebel entschwindenden Legende ist es leichter zusammenzuleben als mit dem lebenden Dichter, der seinen Zeitgenossen so viele Unannehmlichkeiten verursacht hat. Wäre er wirklich auferstanden oder tatsächlich aus einem sibirischen Bleibergwerk heimgekehrt, wäre es ihm gewiß so ergangen wie Dostojewskis Christus in der Geschichte mit dem Großinquisitor: nach seiner Auferstehung erschrak das Volk sosehr vor ihm, daß es ihn gleich wieder kreuzigte.
Auch Petôfi hätte es leicht so ergehen können. Er wartete also nicht mit seinem frühen Tod. Mit dreiundzwanzig Jahren, zwei Jahre vor seinem Ende, sagte er sich das sichere Ende voraus:
• Ein Angsttraum quält mich: Sterben müssen
• in dumpfer Stube, in den Kissen;…
• Nicht solchen Tod, der mir zum Spott,
• nicht solchen Tod gib mir mein Gott!
• …laß mich fallen im Kampf,
• vorstürmend durch Feuer und Dampf!
• Dann möge mein Herzblut verrinnen,
• dann scheide ich glücklich von hinnen!
• Und sollt sich ein Todesschrei mir noch entringen,
• dann mag im Kanonengedröhn er verklingen,
• verwehn mit dem Pfeifen von schwirrendem Stahl,
• mit unseres Sieges Trompetensignal!
• Der Hufschlag der Pferde
• stampf ein in die Erde,
• was von mir noch blieb, wenn nur siegreich die Schlacht,
• die frei von Tyrannen uns endgültig macht! –
• Wenn glorreich dann der Morgen angebrochen,
• dann sammelt ein die Splitter meiner Knochen
• und kommt, mit feierlichen Trauerchören,
• mit schwarzbeflorten Fahnen, uns zu ehren,
• gemeinsam all die Helden zu begraben,
• die für die Weltfreiheit ihr Leben gaben.
• Aus dem Ungarischen von Akos Doma
• Der Autor wurde 1952 in Debrecen geboren; er ist Kunsttheoretiker, Literaturhistoriker und Essayist. László F. Földényi arbeitet seit 1991 als Dozent am Institut für Vergleichende Literaturwissenschaften in Budapest.
• Petôfi-Zitate aus dem Ungarischen von Martin Remané und Josef Steinbach
• Stationen seines Lebens
• 1.1.1823: Sándor Petrovics, später Petôfi, wird in Kiskôrös (Komitat Pest) geboren;
• 1828: Er besucht die evangelische Elementarschule zu Kecskemét; ab 1833 das evangelische Gymnasium in Pest, 1834 das Piaristengymnasium sowie von 1835-39 das in Aszód. Er will Schauspieler werden;
• 1838: „Abschied” – das erste erhaltene Gedicht entsteht;
• 1840: Militärdienst in Sopron und Agra; Ausmusterung wegen Krankheit (1841); schließt sich einer fahrenden Schauspielertruppe an; Werke von Schiller und Heine haben große Wirkung auf ihn;
• 1842: „Der Zecher” – erstes veröffentlichtes Gedicht;
• 1844: Der Dichter Vörösmarty (1800-1855) nimmt sich seiner an; Petôfi schreibt patriotische Versepen, wird Redakteur der Zeitschrift „Pester Modenblatt”; die erste Gedichte-Sammlung erscheint;
• 1846: Zweite Gedichte-Sammlung erscheint; er lebt als freier Schriftsteller; Liebesenttäuschungen und gehässige Kritiken; am 8. September lernt er in Szatmár Júlia Szendrey (1828-1868), seine spätere Frau kennen (Hochzeit am 8.9.1847); die erste Sammlung seiner Gedichte in deutscher Sprache erscheint in Wien (übersetzt von Adolf Dux);
• 1848: am 13.3. dichtet er das „Nationallied”, am 15.3. bricht in Pest ein Aufstand aus, dem Petôfi mit zum Siege verhilft; am 1. Juni kandidiert er für den Reichstag, fällt aber bei der Wahl durch. Er ist Sprecher der revolutionären Demokraten und stellt sich gegen den ungarischen Kompromiß mit Habsburg. Am 15.10. wird er Hauptmann beim Honvédbataillon in Debrecen.
• 1849: Am 25.7. versucht er, Anschluß an die Truppen des polnischen General Bem zu bekommen; am 31.7. erreicht er die mit den Russen im Kampf stehenden ungarischen Honvédtruppen. Am Nachmittag des selben Tages verschwindet er auf dem Schlachtfeld von Segesvár (Siebenbürgen) und ist seitdem verschollen.

DER NEUE PESTER LLOYD – DIE DEUTSCHSPRACHIGE ZEITUNG UNGARNS
Wer ich bin? Ich sag es nicht!
Kann nicht meinen Namen nennen;
keiner darf mich hier erkennen.
Wollt ich meinen Namen sagen,
knüpft man mich gleich auf am Kragen.
Hab, um dem zuvorzukommen,
nicht den Fokosch mitgenommen,
könnt nicht fliehn quer durch die Heide,
denn mein Pferd grast auf der Weide.
Ach, vom Wein brummt mir der Schädel!
Sollt ich dich verlassen, Mädel?
Nein, dann möcht ich lieber sterben!
Wein und Weib sind mein Verderben.
Doch warum mich jetzt schon sorgen?
Anders ist das alles morgen.
Sollt mich dann solch Schnapphahn fragen,
ha, Bescheid werd ich ihm sagen!
Vereitelter Vorsatz
Lang war die Heimfahrt, Stund um Stund
hab ich gedacht nur dies:
Wie grüß ich, Mutter, dich, die ich
vor Jahr und Tag verließ.
Welch innig zartes Kosewort
ruf ich dir zu vergnügt,
streckst du die Hände nach mir aus,
die mich dereinst gewiegt.
Und immer wieder fiel mir ein
ein neues liebes Wort,
die Zeit schien drüber stillzustehn,
der Wagen rollte fort.
Entgegen flog sie mir, als ich
stand auf der Schwelle kaum –
wortlos hing ich an ihrem Mund
wie eine Frucht am Baum.
Ein Abend daheim
Ich saß mit meinem Vater
daheim beim Schoppen Wein.
Nie trank er – mir zuliebe
ging er jetzt darauf ein.
Lang war ich nicht zu Hause,
bekümmert mußt ich sehn,
wie er seither gealtert.
Ja, ja, die Jahre gehn.
Wir schwätzten durcheinander,
wie’s kam, von mancherlei,
und schließlich auch von meiner
Theaterspielerei.
Ein Dorn im Auge war ihm
schon immer dies Metier,
sein Vorurteil dagegen
stand fest wie eh und je.
„Solch Faxenmacherleben
wär mir zu kümmerlich!”
sprach er – das war nicht grade
sehr schmeichelhaft für mich.
„Hast sicher viel gehungert;
so blaß, wie du jetzt bist,
siehst du nicht aus wie einer,
der Purzelbäume schießt.”
Sein kunstkritisches Urteil
konnt ich belächeln nur.
Sinnlos, ihn zu belehren!
Dazu war er zu stur.
Ich sagte ihm statt dessen
ein Trinklied auf; als er
darüber lachen mußte,
da freute ich mich sehr.
Doch, daß sein Sohn auch dichtet,
war ihm gleich einerlei;
brotlose Kunst nur hieß er
die ganze Dichterei.
Was tat’s? Er war ein Metzger,
der Würste machen kann,
für Bücherweisheit gab er
kaum je ein Haupthaar dran.
Drum ging er schweigend schlafen,
nachdem der Krug geleert,
so konnt ich diese Verse
aufschreiben ungestört.
Doch bei der letzten Zeile
trat meine Mutter ein.
Sie stellte hundert Fragen,
ich ließ das Schreiben sein.
Denn alle ihre Fragen
waren so teilnahmsvoll,
wie konnt ich dazu schweigen,
jedwede tat mir wohl.
Jedwede war ein Spiegel,
der mir Gewißheit gab,
daß ich auf dieser Erde
die beste Mutter hab.
Winter
Heut hat sich einer aufgehängt,
jetzt wird es Winter… Mensch und Tiere,
sie schlottern, wie vom Wind geschwenkt,
die Messingteller der Barbiere.
Wem’s schlecht ging, dem geht’s nun noch schlimmer,
nicht jeder hat ein warmes Zimmer.
Der Tagelöhner eilt, eh’s schneit,
mit seinem Weib, Holz kleinzuschlagen,
ihr eingemummter Säugling schreit,
als wollt er so den Wind verjagen.
Wem’s schlecht ging, dem geht’s nun noch schlimmer,
nicht jeder hat ein warmes Zimmer.
Der Wachsoldat vor dem Portal
muß schneller hin und her marschieren,
die Schritte zählt er Mal um Mal,
daß ihm die Füße nicht erfrieren.
Wem’s schlecht ging, dem geht’s nun noch schlimmer,
nicht jeder hat ein warmes Zimmer.
Der Rastelbinder schleppt sich da
im schäbigen Rock auf dürren Beinen,
die Nase rot wie Paprika,
vor Kälte scheint er fast zu weinen.
Wem’s schlecht ging, dem geht’s nun noch schlimmer,
nicht jeder hat ein warmes Zimmer.
Der alte Jahrmarktspieler sucht
von Dorf zu Dorf sich durchzuschlagen,
hat auch kein warmes Zeug, verflucht!
doch Heißhunger genug im Magen.
Wem’s schlecht ging, dem geht’s nun noch schlimmer,
nicht jeder hat ein warmes Zimmer.
Und der Zigeuner… nun, der kann
im Zelt nur zähneklappernd sitzen,
beständig zerrt der Wind daran
und schafft sich Einlaß durch die Ritzen.
Wem’s schlecht ging, dem geht’s nun noch schlimmer,
nicht jeder hat ein warmes Zimmer.
Heut hat sich einer aufgehängt,
jetzt wird es Winter… Mensch und Tiere,
sie schlottern, wie vom Wind geschwenkt,
die Messingteller der Barbiere.
Wem’s schlecht ging, dem geht’s nun noch schlimmer,
nicht jeder hat ein warmes Zimmer.
Auf dem Ochsenwagen
Romantisch war’s, was ich berichte hier,
das hätte sich in Pest nicht zugetragen:
Vornehme Leute setzten sich mit mir
ins Stroh auf einen alten Bauernwagen.
Vier Ochsen waren vorgespannt, die friedlich
den Wagen schleppten die Allee entlang.
Die Ochsen trotteten, ach, so gemütlich
hin durch die Sommernacht im Schneckengang.
Hell war die Nacht, der Mond stand im Zenit,
blaß blinzelnd zwischen zarten Wolkenfetzen,
der Witwe gleich, die bleich zum Friedhof zieht,
des Gatten Grab mit Tränen zu benetzen.
Ein Wind sprang übers Feld und tat sich gütlich
am Duft, der rings aus allen Gräsern drang.
Die Ochsen trotteten, ach, so gemütlich
hin durch die Sommernacht im Schneckengang.
Da war ich nun in diesen Kreis versetzt
von feinen Leuten, die nur müßig schwätzten,
aus Langerweile dann zu guter Letzt
durch das Gesumm von Liedern sich ergötzten.
Und doch war die Gesellschaft unterschiedlich,
das Mädchen neben mir… wie schön und rank!…
Die Ochsen trotteten, ach, so gemütlich
hin durch die Sommernacht im Schneckengang.
„Elisabeth”, sprach ich im Flüsterton,
„wie wär’s, wenn wir uns einen Stern auswählen?
Wenn alle diese Nacht vergessen schon,
soll uns der Stern noch oft davon erzählen!
Der Morgen naht und trennt uns unerbittlich!”
Wir wählten ihn, wobei ich sie umschlang.
Die Ochsen trotteten, ach, so gemütlich
hin durch die Sommernacht im Schneckengang.
Der ungarische Edelmann
Der tapfren Ahnen Heldenschwert,
am Nagel hängt’s, vom Rost verzehrt.
Doch ficht ein bißchen Rost nicht an
mich ungarischen Edelmann.
Wie schön lebt sich’s im Müßiggang!
Die Arbeit macht nur alt und krank.
Den Bauern holt dazu heran
der ungarische Edelmann.
He, Bauer, mach die Straße gut,
sonst schwitzen deine Gäule Blut!
Glaubst du, daß durch den Dreck gehn kann
ein ungarischer Edelmann?
Die Wissenschaft ist nichts für mich,
Gelehrte leben kümmerlich.
Ich rühr kein Buch, kein Schreibzeug an,
ich ungarischer Edelmann.
Als Meister gelt ich nach Gebühr
in einer beßren Kunst dafür:
Bei Sauf und Fraß geht stets voran
der ungarische Edelmann.
Doch Steuern zahle ich nicht, nein!
Das würde mein Ruin bald sein!
Die Schulden wachsen so schon an
beim ungarischen Edelmann.
Was kümmert mich das Vaterland!
Hab selber Sorgen allerhand!
Vielleicht geht’s besser irgendwann
dem ungarischen Edelmann.
Nach altem Recht, im alten Haus
leb ich so hin. – Ist’s mit mir aus,
holt Gott ins Paradies alsdann
mich ungarischen Edelmann.
Der Traum
Der Traum,
der uns ins Land erfüllter Sehnsucht lenkt,
ist wohl das Schönste, was Natur uns schenkt,
ein Glück, das uns vergönnt im Wachen kaum.
Der Arme friert im Traum nicht mehr,
die Qual des Hungers ist gestillt,
er geht in schöne Kleider eingehüllt,
im herrlichsten Gemach auf Teppichen umher.
Der König selbst vergißt,
daß es sein Amt zu strafen und zu richten ist,
schläft friedlich, unbeschwert.
Der Jüngling, dessen Herz verzehrt
verschmähte Liebeslust,
schmilzt hin an der begehrten Brust.
Ich aber brech entzwei
im Traum die Ketten aller Sklaverei!
Mein Schicksal, schaff mir Raum
Mein Schicksal, schaff mir Raum, sinnvoll zu leben,
zu wirken für der Menschheit Wohl!
Weh mir, wenn ungenutzt die reine Flamme,
die in mir brennt, verlöschen soll!
Mag diese Flamme mich auch ganz verzehren,
vom Himmel ward sie mir zuteil.
Mit jedem Schlage fleht mein Herz inbrünstig
um aller Menschen Glück und Heil.
Doch fleht’s nicht nur darum mit leeren Worten,
nein, all mein Tun sei der Beweis,
wär auch ein neues Kreuz für diese Taten,
ein neues Golgatha mein Preis.
Ja, für der Menschheit Glück gäb ich mein Leben,
der schönste Tod wär dies, fürwahr!
Gern möcht ich alles dafür geben,
den höchsten Rausch der Lust sogar!
Schicksal, versprich es mir, daß ich so sterbe!
Gern richt ich auf mit eigner Hand
das heilige Marterholz, daran mich kreuzigt
der Menschheitsfeinde Unverstand.
Oh, käm ein Sturm…
Oh, käm ein Sturm, dessen Gewalt
aufreißt am Himmel einen Spalt
und wirft hinein quer durch das All
diesen verdammten Erdenball!
Ach, Erde, welch ein Durst…
Ach, Erde, welch ein Durst mag in dir brennen,
daß Blut und Tränen nie ihn löschen können!
So wie der Zweig erzittert
So wie der Zweig erzittert,
schwingt sich der Vogel darauf,
zittre auch ich, steigt dein Bildnis
vor meiner Seele auf.
Dein muß ich immerdar denken,
Mädchen, Herzliebste mein,
bist dieser schönen Erde
herrlichster Edelstein.
So wie im Frühling die Donau
über die Ufer drängt,
wogt mir im Herzen die Liebe,
daß mir’s die Brust fast sprengt.
Liebst du mich noch, süße Rose?
Heiß wie dereinst lieb ich dich!
Vater und Mutter lieben
treuer dich nicht alsich.
Sommer war’s, als wir uns fanden,
da warst du zärtlich und lieb.
Seit uns der Winter trennte,
scheint alles kalt und trüb.
Gott mag dich segnen, Herzliebste,
wenn du mir treu nicht bliebst…
Tausendmal soll er dich segnen,
wenn du wie einst mich liebst!
Ein Angsttraum quält mich…
Ein Angsttraum quält mich: Sterben müssen
in dumpfer Stube, in den Kissen;
verwelken elend, schmerzgeplagt,
der Blume gleich, vom Wurm zernagt;
langsam verlöschen wie der Kerze Schimmer,
die man vergaß in dem verlaßnen Zimmer.
Nicht solchen Tod, der mir zum Spott,
nicht solchen Tod gib mir, mein Gott!
Möcht sterben wie ein Baum, umwettert,
vom Sturm gefällt, vom Blitz zerschmettert,
möcht fallen wie der Fels einmal,
vom Donnerschlag gestürzt ins Tal…
Wenn die versklavten Völker sich ermannen,
des Joches müde, gegen die Tyrannen
mit roten Fahnen zornig ziehn ins Feld
und ihre Losung gellt:
„Feiheit der Welt!”,
wenn diesen Ruf ich wie Posaunenchöre
machtvoll in Ost und West erschallen höre –
dann will ich fallen im Kampf,
stürmend durch Feuer und Dampf!
Möge mein Herzblut verrinnen,
glücklich scheid ich von hinnen!
Sollt sich ein Todesschrei mir noch entringen,
mag im Kanonengedröhn er verkfingen,
verwehn mit dem Pfeifen von schwirrendem Stahl,
mit unseres Sieges Trompetensignal!
Der Hufschlag der Pferde
stampf ein in die Erde,
was von mir noch blieb, wenn nur siegreich die Schlacht,
die frei von Tyrannen uns endgültig macht!…
Wenn glorreich dann der Morgen angebrochen,
dann sammelt ein die Splitter meiner Knochen
und kommt, mit feierlichen Trauerchören,
mit schwarzbeflorten Fahnen, uns zu ehren,
gemeinsam all die Helden zu begraben,
die für die Weltfreiheit ihr Leben gaben.
Ich denke oft darüber nach…
Ich denke oft: Mir tät’s nicht leid,
wenn irgendwann
das Weltsystem zerbricht, und dann
wie Schnee und Hagel fallen heut,
vom Himmel Sterne niederflössen
und Sternenbäche sich ergössen.
Schläfst du, Gerechtigkeit?…
Schläfst du, Gerechtigkeit, bist du gar tot?
War dieser Mann nicht wert, daß um den Hals
ihm eine goldne Ehrenkette hing’?
Statt dessen hängt er selbst am Henkerstrang!
Und seht, die Kette schmückt des Henkers Hals,
des Henkers, der am Strange hängen müßt’!
Schläfst du, Gerechtigkeit, bist du gar tot?…
Freiheit und Liebe
Freiheit und Liebe
sind all mein Streben!
Für meine Liebe
könnt’ ich das Leben,
doch für die Freiheit
die Liebe selbst geben.
Bist du als Mann geboren
Bist du als Mann geboren,
dann wank und schwanke nicht
bei jedem Schlag des Schicksals,
gleich einem feigen Wicht.
Das Schicksal ist ein Kläffer,
der schnell den Schwanz einzieht,
wenn man ihm unerschrocken
fest in die Augen sieht.
Bist du als Mann geboren,
dein Tun beweise es!
So klar wie Taten sprechen,
spricht kein Demosthenes.
Du magst erbaun, zerstören,
doch wenn dein Werk getan,
rühm dich nicht deiner Taten,
verstumm wie der Orkan.
Bist du als Mann geboren,
zeig’s durch Bekennermut,
und müßtest du’s bezahlen
sogleich mit deinem Blut.
Das Leben mag vergehen,
was dir als Wahrheit gilt,
verleugne nicht, bewahr es
wie deiner Ehre Schild.
Bist du als Mann geboren,
gib um die Gunst der Welt
nicht auf dein freies Leben,
noch gar um schnödes Geld.
Mit käuflichen Subjekten
mach niemals dich gemein!
Nein! „Bettelstab und Freiheit!”
laß deine Losung sein.
Bist du als Mann geboren,
zeig stets dich stark und fest
als Kerl, der sich vom Schicksal
nicht unterkriegen läßt,
der keine Feinde fürchtet,
ein unbeugsamer Mann,
der Eiche gleich, die stürzen,
doch nie sich krümmen kann.
Die Dichter des 19. Jahrhunderts
Kein Sänger sollte in die Saiten
ohne Besinnen greifeu heut,
denn hohe Pflichten zu erfüllen
hat der Poet in dieser Zeit!
Wer nur von seiner eignen Freude,
vom eignen Schmerz sich fühlt bewegt,
ist nicht vonnöten und tut besser,
wenn er die Laute niederlegt.
Wir irren heute in der Wüste
wie einst das Volk von Israel,
doch Moses, der der Feuersäule
Jehovas folgte, ging nicht fehl.
Uns hat der Schöpfer heut den Dichter
als Fackel für den Weg gesandt,
als Führer, der das Volk geleite
ins heilige, Gelobte Land.
So führt das Volk voran, ihr Dichter,
durch Feuer, Flut und Wüstensand!
Fluch dem, der sinken läßt die Fahne
und wegwirft gar mit feiger Hand!
Fluch allen, die sich ferne halten
aus Trägheit und Bequemlichkeit,
im sichren Schatten ruhn, indessen
das Volk nur Mühe kennt und Leid.
Falsche Propheten gibt’s, die sagen:
„Legt doch die Waffen aus der Hand!
Was ihr ersehnt, ist längst errungen!
Ihr lebt schon im Gelobten Land!”
Doch Lüge ist’s! Seht die Millionen,
die tot sich rackern rings im Feld
und mühsam nur ihr Leben fristen,
von Durst und Hunger stets gequält!
Erst dann, wenn jeder gleichberechtigt
Platz nehmen darf am Tisch der Welt,
erst dann, wenn jeder gleichennaßen
sein Teil vom Überfluß erhält,
wenn durch die Fenster aller Hütten
das Licht der Bildung Einzug fand,
erst dann ist’s Zeit für uns zu rasten,
erreicht ist das Gelobte Land.
Solange darf’s nicht Ruhe geben,
kein Ende unseres Gerichts!
Lohnt unsre Opfer, unsre Mühe
die Welt dereinst uns auch durch nichts,
der Tod wird unsre Augen küssen,
selig sinkt unser Leib hinab
und schläft mit ruhigem Gewissen
im wohlverdienten, stillen Grab.
Die Theiß
Eines Sommerabends stand ich lange
an der Theiß, da, wo wie eine Schlange
sie sich windet und die Túr [2] empfängt,
die sich wie ein Kind zur Mutter drängt.
Zwischen seinen lockren Uferrändern
sah ich zahm und glatt den Strom hinschlendern,
so als wollt er, daß der Sonne Gold
ungestört sich in ihm baden sollt.
Auf dem blanken Spiegel sah ich schimmern,
tänzelnd ihre roten Strahlen flimmern,
wie mit winzigen Sporen, silberfein
klirrend, gleich als ob es Feen sein.
Gelber Sand vor mir das Ufer deckte,
das sich wie ein Teppich weit erstreckte
bis zum Feld, wo Grummet lag gemäht,
wie im Buch die Zeilenfolge steht.
Jenseits von der Wiese sah man dunkeln
schon den Hochwald, doch die Kronen funkeln
purpurn in der Abendröte Glut,
so als göß er brennend aus sein Blut.
Haselsträucher, Ginsterbüsche streute
die Natur entlang der andern Seite,
und hindurch, von ihrem Grün umsäumt,
lugte eines Kirchleins Turm verträumt.
Süß mich in Erinnerung zu wiegen,
sah ich Rosenwölkchen drüber fliegen
und wie sinnend in der Ferne stehn
nebelgrau die Marmaroscher Höhn.
Selten pfiff ein Vogel zaghaft leise,
fern nur sang ein Mühlrad seine Weise,
säuselnd wie des Mückenspiels Gesumm.
Feierlicher Friede war ringsum.
Drüben sah ein Bauernweib ich kommen.
Als sie Wasser mit dem Krug genommen,
warf sie prüfend einen Blick auf mich,
wie verwundert und entfernte sich.
Seltsam mußte ich ihr wohl erscheinen,
denn wie angewurzelt mit den Beinen
stand ich stumm und reglos, wie entrückt,
von dem Zauber der Natur beglückt.
Groß bist du, Natur, du wunderreiche,
meiner Sprache fehlen die Vergleiche,
dich zu schildern, deine Schönheit zeigst
du so anmutsvoll nur, wenn du schweigst.
Spät erst kam ich an bei den Gefährten.
Nach der Obstmahlzeit, die wir verzehrten,
haben plaudernd wir die halbe Nacht
dann beim Reisigfeuer noch durchwacht.
„Schmäht mir nicht die Theiß!” sprach ich zu ihnen.
„Zahm und friedlich ist sie mir erschienen,
als ich heut an ihrem Ufer stand.
Sanfter fließt kein Fluß in unsrem Land!”
Doch wie schrak ich auf nach ein paar Tagen!
Plötzlich fingen an Alarm zu schlagen
aufgeregt die Glocken ringsumher.
Und schon wogte Wasser wie ein Meer,
hatte schon die Dämme übersprungen,
war schon übers Feld ins Dorf gedrungen!
Rasend kam die Theißflut angerollt,
als ob sie die Welt verschlingen wollt!
Kampf war…
Kampf war meines Lebens Inhalt,
Weg und Ziel bis heut,
Kampf, in dem man für die Freiheit
selbst den Tod nicht scheut.
Ja, das Sakrament der Freiheit
ist des Blutes wert,
wert, sich selbst das Grab zu graben
mit dem eignen Schwert.
Einzig Sakrament der Freiheit!
Wahnbesessen sind,
die für andere Idole
je sich opfern blind.
Frieden, doch nicht den der Willkür!
Frieden aller Welt,
Frieden, den man aus der Freiheit
heiliger Hand erhält!
Gibt es einstmals solchen Frieden,
werfen wir zur Stund
unsre blutbefleckten Waffen
auf des Meeres Grund.
Doch bis dahin müssen Waffen
führen Schlag um Schlag,
währt auch Kampf und Blutvergießen
bis zum Jüngsten Tag!
Das Gericht
Habe das Buch der Geschichte
nun ganz bis zum Ende durchblättert.
Ach, die Geschichte der Menschen,
was ist sie? – Ein Blutstrom, entsprungen
finstrer Vergangenheit Felsen,
der fern schon im Nebel versunken.
Dennoch, der Blutstrom ergießt sich
noch fort bis in unsere Tage.
Glaubt nicht, die grausigen Fluten,
sie würden nun endlich versiegen!
Nein, die entfesselten finden
im Schoße des Meeres erst Ruhe.
Erst in dem Blutmeer der Erde
erreicht dieser Blutstrom sein Ende.
Furchtbaren Tagen noch gehen
die leidenden Menschen entgegen,
Tagen, so schrecklich, wie nie sie
die Sterblichen haben gesehen.
Wehe! Der jetzige Friede,
er ist nur die täuschende Stille,
die nach dem Blitzschlag unheimlich
dem Grollen des Donners vorausgeht.
Aber ich kenn deinen Schleier,
geheimnisvoll dräuende Zukunft,
ich kann durchschauen und ahnen,
entzünd ich die Feuer der Feen,
was du dahinter verborgen
noch hältst dem nichtsahnenden Volke.
Graust es mich, schaudert’s mich auch,
so stimmt es zugleich mich auch fröhlich.
Ja, mit unbändiger Freude
erblick ich den Kriegsgott aufs neue,
wie er mit Helm und mit Panzer
sich rüstet und greift nach dem Schwerte.
Wieder besteigt er sein Streitroß
und stürmt durch die Weiten der Erde,
fordert heraus alle Völker
zum letzten, entscheidenden Kampfe.
Zwei Parteien nur stehen sich
dann gegenüber als Feinde:
Böse und Gute bekämpfen sich,
grimmig auf Tod oder Leben.
Sieger sein werden die Guten,
die immer Verlierer nur waren.
Mag es ein Blutbad auch werden,
doch das durch den Mund der Propheten
lange vom Schöpfer versprochne
gerechte Gericht wird es werden.
Aber nach diesem Gericht wird
ein besseres Leben beginnen,
glückselig sein wird die Menschheit,
nicht nötig mehr wird sie es haben,
sich um den Himmel zu sorgen:
zur Welt schwebt der Himmel hernieder.
Helden in Lumpen
Auch ich könnt meine Verse kleiden
in schöne Reime, strenge Form,
geschniegelt nach der Etikette,
die in Salons der Noblen Norm.
Doch meine Lieder sind nicht Gecken,
die albern auf Empfänge gehn
mit Handschuhn, parfümierten Locken,
begierig nur nach Weibern sehn.
Zwar nicht mit Schwertern und Kanonen,
die lange schon der Rost befiel,
wird heut gekämpft, nein: mit Ideen.
Doch ist auch das kein Kinderspiel.
In diesen Schlachten des Jahrhunderts
bin als Soldat ich eingereiht,
und meine Lieder sind getreue
Vorkämpfer in dem harten Streit.
Arm sehn sie aus, zerfranst, zerschlissen,
doch groß ist ihre Tapferkeit,
und Heldenmut ehrt den Soldaten
mehr als ein goldbetreßtes Kleid.
Ob sie mich überleben werden,
die Sorge quält mich heute nicht.
Sie mögen ohne Ruhm vergehen,
erfüllten sie nur ihre Pflicht.
Ein Buch, das meine schlichten Lieder
bewahrt, ehrwürdig wird es sein
wie Gräber namenloser Helden,
die für die Freiheit standen ein.
Brief an János Arany
Lebst du nicht mehr, oder lähmte
der Schreibkrampf die Hand dir, Freund Jankó?
Hast du gar gänzlich vergessen,
daß ich auf der Erde noch wandle?
Was ist geschehen? Zum Teufel!
Kein Wörtchen mehr läßt du verlauten!
Hat dich der Ewigkeit Wiege,
das Grab schon, das finstre, verschlungen,
ruh dann in Frieden, mein Bester,
hab liebliche Träume da unten!
Nimmer mit Fragen und Rügen
werd ich dir die Ruhe dort stören.
Andernfalls sage mir endlich,
warum du so säumig im Schreiben?
War’s nur der Schreibkrampf, besorg dir
ein Mittel vom Herrn Apotheker,
um zu genesen, mein Lieber!
Doch dann greife schleunigst zur Feder!
Hast du mich aber vergessen,
vergessen den Freund, deinen besten,
treuloser Bruder, dann bleibe
für immer auch du mir gestohlen.
Weißt du nicht, was du mir schuldest,
du, der in granitharte Felsen
Lettern mit Stahl hat geschnitten,
die nimmermehr werden vergehen?
Meinst du, ich hätt meinen Namen
in flüchtigen Sand nur gekritzelt,
daß ihn im Lauf von vier Wochen
ein Windhauch schon könnte verwehen?
Recht würde mir dann geschehen!
Doch daß ich auch Schlechtes geschrieben,
halte ich eher für möglich,
als daß du mich je ganz vergäßest.
Ach, nur zu faul, nur zu träge
zum Schreiben bist du wie ich selber!
Wenn ich’s schon bin, könntest du nicht
um einiges fleißiger werden?
Mir mag die Faulheit wohl anstehn,
doch könntest du selbst drauf verzichten,
wenn ich dich sehr darum bitte?
Du tust es! Ich seh dich schon springen,
seh dich zur Feder schon greifen,
entschlossen die spitzige Nase
eintauchen schon in die Tinte
und endlose Furchen schon ziehen,
säen ins Feld des Papyros
die Fetzen tiefgründiger Ideen…
Aber mit solcherlei Briefen,
die voll sind von weisen Gedanken,
sollst du dich ja nicht belasten,
auch mir nicht den Magen beschweren.
Nichts will mir närrischer scheinen
als philosophierende Briefe.
Wahrlich, sie sind mir ein Greuel,
vielleicht, weil ich selber unfähig,
jemals solch Zeug zu verfassen,
so glaub ich; doch daß mir’s zuwider,
schwöre ich bei meiner Pfeife,
beim Tabak, bei einem Topf Fleckerln
und allen sonstigen Dingen,
die mir auf der Erde hier heilig…
Inständig möchte ich bitten
Euch, liebe Gevatterin, gleichfalls,
tüchtig zu schelten den Nichtsnutz,
mit Prügeln ihn auch zu bedrohen,
wenn er nicht endlich sich aufrafft,
mir möglichst ausführlich zu schreiben.
Schreibt er mir nur ein paar Zeilen,
erwähnt er Euch selbst nur am Rande,
werd ich, je kürzer sein Brief ist,
ihn dann um so länger verfluchen!
Ebenso soll er von Laci
und Julis, den Kindern, berichten,
auch wie es aussieht im Garten,
ob’s gut um die Rosen bestellt ist,
die ich so oft voll Entzücken,
mit staunenden Augen betrachtet,
während die träumende Seele
der treuen Geliebten gedachte.
Hält sich der Turmstumpf noch aufrecht,
der kampfmüde nutzlos hochreckte
seine von spärlichen Gräsern
bekränzte todtraurige Stirne?
Harrt er noch schweigend des Tages,
an dem ihm der Tod mit dem Fuße
wie einem Bettler die Krücke
wegstößt, daß er bricht in die Knie?
Nistet noch immer wie früher
der Storch auf dem alten Gemäuer,
schaut er noch aus in die Weite
so ernst und trübsinnig wie damals?
Ja, von all dem will ich hören,
was lieb mir bei euch einst gewesen.
Schönere Gegenden hab ich,
seitdem ich bei euch war, gesehen,
aber die eure wird immer
in bester Erinn’rung mir bleiben,
ewig im Herzen bewahr ich
die Tage, die bei euch verbrachten.
Was ich seither auch erlebte
in glänzenden, großen Palästen,
klein schien mir alles dagegen,
besonders die Seele der Herren.
Immerfort mußt ich dort denken
an eure so schlichte Behausung.
Winzig nur waren die Räume,
doch groß war die Seele des Wirtes!…
Doch, will der Teufel mich reiten?
Wie kann ich so maßlos dich loben!
All das ist schändlich gelogen!
Wie kommt’s daß ich’s jetzt erst bemerke?
Mit diesen Lobhudeleien
versuchte ich, dich zu bestechen,
dachte wohl, daß Herr Notar mich
dort unterzubringen geneigt sei,
etwa als Schweinehirt oder
als Nachtwächter in seinem Dörfchen,
wenn vielleicht zufällig grade
vakant wird solch lohnender Posten!
Tja, auch für mich wird es Zeit jetzt,
nach Einkommen Ausschau zu halten.
Heiraten, wie ich dir sagte,
werd selber ich nun wohl in Bälde,
meine Domäne läßt aber
an Geldern mir gar nichts zufließen,
weil sie mein Ur-Urgroßvater
verkaufte, eh er sie erworben.
Da mir’s an Einkommen mangelt,
ist nicht olme Amt auszukommen,
werd ich mich beugen wohl müssen
und lernen bestrickend zu lächeln,
artig zu sein und zu heucheln,
zu lügen, zu kriechen, zu schmeicheln,
nur um das nötige Schmalzbrot
für mich zu verdienen… pfui Teufel!
Ach, schon der bloße Gedanke
versetzt mich in panischen Schrecken.
Feurige Nebel erheben
sich vor meinen zornroten Augen.
Fast will das Herz mir zerspringen
wie einem dreijährigen Fohlen,
wenn um den Hals ihm der Hirte
ganz plötzlich die Fangleine schleudert,
um mit Gewalt es zu zerren
aus seinem Gestüt an die Deichsel.
Furcht hat es nicht vor den Lasten,
die man es zu ziehen wird heißen,
nein, vor dem Strang nur erschrickt es,
der’s zwingt, auf dem Fleck zu verharren.
Was ihm die Freiheit bedeutet,
das wird ihm nie wieder ersetzen
weder das köstlichste Futter
noch kostbares, glänzendes Zaumzeug.
Eitel erscheint ihm dies alles,
mit Pußtagras wär es zufrieden,
möge es mager auch bleiben
und schutzlos im Sturmregen stehen,
Hagel die Flanken ihm peitschen,
Gestrüpp ihm zerfetzen die Mähne,
wär’s auch zu fliehen gezwungen,
entweichend den Schlangen der Blitze,
wild mit dem Sturm um die Wette,
wenn’s nur seine Freiheit bewahrte.
Gott nun zum Gruß, ihr Getreuen!
Zwar hätte noch gern meine Seele
Kurzweil gehabt mit euch beiden,
doch blähte der Phantasie Segel
längst schon zu prall sich im Winde,
der jählings vom Strand mich entfernte,
bis sich mein Ankerseil löste
und forttrieb die schwache Galeere.
Schwankend auf schäumigen Wogen,
im unübersehbaren Meere,
rings von Orkanen umdonnert,
von schwarzem Gewittergewölke,
greift meine Hand in die Saiten,
und trunken von wilder Begeistrung
sing ich dir noch eine Hymne,
du hundertfach heilige Freiheit!
Der Herbstwindflüstert…
Der Herbstwind flüstert traurig mit den Bäumen,
geheimnisvoll ist seiner Rede Sinn,
die Bäume lauschen ihm, und wispernd wiegen
sie nachdenklich die Köpfe her und hin.
Nachmittag ist’s, aufs Sofa hingesunken
lieg lesend ich, zur Seite mir gesellt,
in meinen Arm ihr Köpfchen friedlich schmiegend,
schläft meine kleine Frau, entrückt der Welt.
Ich fühle ihren Herzschlag mit der Linken,
die ihre süße Brust umfangen hält,
ein heiliges Buch halt ich in meiner Rechten,
das von der Völker Freiheitskampf erzählt.
Und jede Letter tanzt vor meiner Seele
wie ein Komet, der feurig niederfällt…
In meinen Arm ihr Köpfchen friedlich schmiegend,
schläft meine kleine Frau, entrückt der Welt.
Für schäbigen Sold, getrieben von der Peitsche,
dienten die Sklaven der Tyrannen Macht,
die Freiheit aber brauchte nur zu lächeln,
schon zog, wer treu ihr war, für sie zur Schlacht.
Und wie von einem schönen Mädchen Blumen,
nahm Wunden man und Tod von ihr im Feld…
In meinen Arm ihr Köpfchen friedlich schmiegend,
schläft meine kleine Frau, entrückt der Welt.
Wie viele Edle sind für dich gefallen,
o heilige Freiheit, in verlornem Krieg!
Und trotzdem wirst du schließlich triumphieren!
Der letzte Kampf bringt dir gewiß den Sieg!
Und alle deine Toten wirst du rächen,
wenn dein gerechtes Schwert Gerichtstag hält!…
In meinen Arm ihr Köpfchen friedlich schmiegend,
schläft meine kleine Frau, entrückt der Welt.
Vorüber seh ich ziehen schon im Geiste
die Schreckensbilder zukünftiger Zeit,
der Freiheit Feinde sehe ich ersaufen
im eignen Blut ohne Barmherzigkeit!
Mein Herz, es hämmert in der Brust rachlüstern,
und Blitz und Donner mir im Schädel gellt…
In meinen Arm ihr Köpfchen friedlich schmiegend,
schläft meine kleine Frau, entrückt der Welt.
September-Ausklang
Wie freundlich vorm Fenster die Blumen noch blühen,
die Pappel, sie trägt noch ihr sommerlich Kleid!
Doch siehst du im Norden schon Schneegewölk ziehen,
und hoch in den Bergen, da hat’s schon geschneit.
Noch fühl ich durchpulst mich vom Sommer wie immer,
der Säfte der Jugend mich noch nicht beraubt,
doch zeigen die Schläfen schon silbernen Schimmer,
der Rauhreif des Winters sinkt sacht auf mein Haupt.
Die Jugend wird welken, das Leben verfliegen…
Komm zu mir, mein Weib, daß im Arm ich dich hab,
komm, neig deinen Kopf, an mein Herz dich zu schmiegen!
Vielleicht neigst du so dich bald über mein Grab…
Sag, wirst du das Bahrtuch dann über mich legen
und schwören, daß nie einen andern du liebst,
kein andrer dich jemals vermag zu bewegen,
daß du meines Namens dich treulos begibst?
Doch willst du nicht länger die Witwentracht tragen,
dann wirf deinen Schleier getrost auf mein Grab!
Ich steige herauf aus dem finsteren Schragen
und hole ihn mir in die Grube hinab.
Abtrocknen will ich mir damit alle Tränen,
die ich um dich weinte – brachst du auch dein Wort.
Denn ewiglich werde ich mich nach dir sehnen,
nach dir, die ich liebe – auch dort noch, auch dort!
Wie der Rosenbusch
Wie der Rosenbusch am Hügel dort
lehne dich an mich, geh nicht mehr fort!
Flüstre mir ins Ohr: Ich bin dir gut!
Ach, wie wohl das meinem Herzen tut!
Wie der Sonne Bild sich badend schmiegt
in den Fluß, von seiner Flut gewiegt,
schmiege, Liebste, dich an meine Brust!
Wiegen will ich dich nach Herzenslust!
Gottesleugner nennt mich manch ein Wicht,
doch, mein Engel, glaub den Schwätzern nicht.
Betend lausch ich deines Herzens Schlag,
fromm, wie es kein andrer wohl vermag.
Herr Pál Pató
Wie in Zauberschlaf versunken,
döste mürrisch, nie recht froh,
vor sich hin in seinem Dorfe
unbeweibt Herr Pál Pató.
Fragte wer: „Aus welchem Grunde
hat der Herr noch nicht gefreit?” –
fiel er gleich ins Wort dem Frager:
„Hochzeit machen? Hat noch Zeit!”
Längst schon stand sein Haus verfallen,
Putz war kaum noch an der Wand,
und mit einem Teil des Daches
war der Wind davongerannt.
Fragte wer: „Sollt man’s nicht decken,
eh es regnet oder schneit?” –
fiel er gleich ins Wort dem Frager:
„Dach eindecken? Hat noch Zeit!”
Ganz verwahrlost lag der Garten,
Mohn und Unkraut trug das Feld.
Fragte wer: „Laßt Ihr die Äcker
heuer alle unbestellt,
weil die Knechte lieber bummeln
und der Pflug die Arbeit scheut?” –
fiel er gleich ins Wort dem Frager:
„Feld bestellen? Hat noch Zeit!”
Schon ganz mürb war seine Hose
und der Dolman abgewetzt,
keins von beiden hätte notfalls
nur ein Mückennetz ersetzt.
Fragte wer: „Wo bleibt der Schneider?
Liegt nicht längst der Flaus bereit?” –
fiel er gleich ins Wort dem Frager:
„Anzug machen? Hat noch Zeit!”
Und so fristet er sein Leben
ärmlich, immer ohne Geld,
er, der von den Vätern erbte
Haus und Hof und Vieh und Feld.
Laßt uns müßige Worte sparen,
denn bekannt ist weit und breit
längst die Losung der Magyaren:
„Keine Sorge, hat noch Zeit!”
Auf der Eisenbahn
Ob der Wunder dieser Zeit
fühl ich maßloses Vergnügen!
Nicht der Vogel nur kann fliegen,
auch der Mensch hat Flügel heut!
Längst flog die Idee voran,
hätten mehr uns eilen sollen,
aber sie zu überholen
sind wir jetzt schon drauf und dran.
Mensch und Haus und Bach und Baum
tauchen auf nur für Sekunden,
sind oft unbemerkt entschwunden,
schnell zerflossen wie ein Traum.
Auch die Sonne möchte gar
wie ein Irrer fort sich machen,
der verfolgt sich wähnt von Drachen
oder einer Teufelsschar
und entflieht, als ob der Tod
ihm bereits im Nacken sitze.
Hinter eines Berges Spitze
sinkt sie hin, vor Scham ganz rot.
Wir, wir fliegen wie beschwingt
fort mit Fauchen und Gebimmel,
grad so, als ob in den Himmel
unser Feuerroß uns bringt.
Vorwärts! Uns hält nichts mehr auf!
Tausend Bahnen baut und Gleise,
daß die Welt ein Strom durchkreise
gleich der Adern Blutkreislauf!
Mögen so in jedes Land
neue Lebenssäfte fließen,
Geist und Wissen sich ergießen,
wie’s die Erde nie gekannt.
Hätten längst nach Recht und Fug
solche Bahnen bauen müssen.
Eisen gab’s, hätt man zerissen
alle Ketten, stets genug!
Wie könnte ich dich nennen?
Wie könnt ich dich mit Namen nennen,
wenn ich in traumversunkner Dämmerung
vor deinen zauberhaften Augen
erstaune wie vorm Glanz des Venussterns,
als säh ich dich zum erstenmal.
Im Anblick dieser Augensterne,
von denen jeder Strahl
ein Strom der Liebe ist,
der sich in meiner Seele Meer ergießt…
Wie könnte ich dich nennen?
Wie könnt ich dich mit Namen nennen,
wenn mir dein Blick entgegenfliegt,
der sanfter leuchtet als das Auge
der Taube, deren schimmerndes Gefieder
dem Palmenzweig des Friedens gleicht
und mir unsagbar wohltut, weil
er weicher ist als Kissen in der Wiege
und zärtlicher als feinste Seide, die
die heiße Stirn mir streift…
Wie könnte ich dich nennen?
Wie könnt ich dich mit Namen nennen,
wenn deine Stimme mir erklingt,
die Stimme, die den Baum im Winter,
der sie vernehmen könnt, zu grünen zwänge
und übervoll mit Blüten sich zu schmücken,
dieweil er glaubt,
er hör das Lied der Nachtigall,
die ihm die langerwartete Erlösung kündet,
die holde Frühlingszeit…
Wie könnte ich dich nennen?
Wie könnt ich dich mit Namen nennen,
wenn deine Lippen sich auf meinen Mund
wie feurige Rubine pressen
und unsre Seelen schmelzen hin im Kuß,
wie Nacht und Tag
im Frührot sich vereinen,
wenn Zeit und Raum vor mir versinken,
die Ewigkeit mich überflutet
mit ungeahnter Seligkeit…
Wie könnte ich dich nennen?
Wie könnt ich dich mit Namen nennen,
du Mutter meines größten Glücks,
du holde Feentochter meiner
himmelerstürmenden Visionen,
du meiner höchsten, kühnsten Hoffnung
erstaunlichste Verwirklichung,
du meiner Seele höchstes Kleinod,
wertvoller als die ganze Welt,
mein Weib, mein junges, wunderbares…
Wie könnte ich dich nennen?
Winterabend
Himmelsregenbogen, wo bist du geblieben?
Bunte Wiesenblumen, wer hat euch vertrieben?
Festgewand des Frühlings, holde Sommergaben,
lieblich Bachgemurmel, süße Vogellieder,
ach, dahingeschwunden seid ihr, wie begraben,
kehrt wie blasse Schatten nur im Traum uns wieder.
Ausgeraubt vom Winter, bettelarm geworden
ist die kahle Erde unterm Wind von Norden.
Einem greisen Bettler gleicht sie, dessen Rücken
schnee- und eisbedeckt ist wie von weißen Flicken,
dessen Rock zerfetzt ist, daß an vielen Stellen
man den nackten Leib sieht, der vor Kälte schauert.
So erbarmungswürdig, ohne zu verhehlen
ihre ganze Armut, steht sie da und trauert,
da sie ihren Kindern nichts mehr hat zu geben,
die in dumpfen Stuben nunmehr müssen leben.
Darum sei Gott dankbar jeder, der jetzt friedlich
sitzen kann am eignen warmen Herd gemütlich,
lachen kann und scherzen in der Seinen Mitte,
ohne sich zu sorgen! Welch ein Himmelssegen!
Zum Palast wird wahrlich selbst die kleinste Hütte,
hat man reichlich Brennholz in den Herd zu legen.
Gute Worte, welche draußen schnell verhallen,
haften hier im Herzen, wohlbewahrt von allen.
Wahrlich schön sind hier die Winterabendstunden,
stumpf ist, wer noch niemals ihren Reiz empfunden.
Seine Pfeife paffend, sitzt am Tisch der Vater,
vor sich die Karaffe, die voll altem Wein ist,
mit dem Nachbar plaudernd oder dem Gevatter
über dies und jenes, ob es groß, ob’s klein ist.
Was sie auch beim Trinken suchen zu ergründen,
voll ist die Karaffe, eh den Grund sie finden.
Denn die brave Hausfrau füllt sie unterdessen
immer wieder! Niemals könnt sie es vergessen.
Ja, was hier zu tun ist, weiß sie selbst am besten,
sie kennt ihre Pflichten, hält auf Hausfraunehre,
nie versäumt sie, was sie schuldig ist den Gästen.
Keiner soll behaupten, daß sie geizig wäre!
Spricht mit jedem freundlich, wie es Brauch und Sitte:
„Wohl bekomm’s, Herr Nachbar! Noch ein Gläschen? Bitte!”
Höflich danken alle, eh zum Glas sie greifen,
immer wieder stopfen sie die leeren Pfeifen.
Wie die Tabakswolken ringsumher sich kringeln
und zur Decke wirbeln, wirbeln die Gedanken
ihnen durch die Köpfe, um mit krausen Ringeln
Dinge zu umranken, die schon längst versanken.
Denn, wer nicht mehr ferne von des Lebens Grenzen,
träumt nur vom Vergangnen, nicht von künftigen Lenzen.
Doch die jungen Leute, welche abseits sitzen,
schauen noch nicht rückwärts; wozu könnt es nützen,
in vergangnen Dingen schon herumzuwühlen!
Taufrisch strahlt vor ihnen noch des Lebens Morgen,
ihre Seelen träumen von zukünftigen Zielen,
ohne um des Alltags Mühsal sich zu sorgen.
Bursch und Mädchen lächeln sich nur zu und denken:
Überflüssige Worte können wir uns schenken.
In der Ofenecke, da rumort und krabbelt
all das kleine Kroppzeug, das noch plärrt und sabbelt.
Ein paar Größre aber sieht man auch darunter.
Kartenhäuser baun sie, um sie zu zerstören…
Wie nach Eintagsfaltern jagend, sorglos, munter,
denken nur ans Heute, diese drolligen Gören.
Gestern, Heut und Morgen sieht man hier versammelt,
und so ist die Stube mehr als vollgerammelt.
In der Diele draußen hört die Magd man singen,
die zum Backtag Mehl siebt, und vom Hof her dringen
Hufgetrappel und des Brunnenschwengels Knarren,
denn die Pferde führt der Knecht zur Abendtränke.
Dumpf hallt aus der Ferne der Baßgeige Schnarren,
die Zigeuner spielen in der alten Schenke.
Alle diese Töne, grobe, grelle, leise,
einen sich harmonisch hier zu einer Weise.
Jetzt beginnt’s zu schneien, finster sind die Gassen,
zugedeckt von schwarzer Nacht urid ganz verlassen.
Selten nur noch sieht man einen Lichtschein funkeln
durch die Fensterscheiben, doch nur für Sekunden,
wenn mit der Laterne noch ein Mensch im Dunkeln
heimhuscht wie ein Schatten, der sogleich verschwunden,
kaum, daß in der Stube man hat angefangen
mit dem großen Raten, wer vorbeigegangen.
Nationallied
Auf, die Heimat ruft, Magyaren!
Zeit ist’s, euch zum Kampf zu scharen!
Wollt ihr frei sein oder Knechte?
Wählt! Es geht um Ehr und Rechtei
Schwören wir beim Gott der Ahnen:
Nimmermehr
beugen wir uns den Tyrannen!
Nimmermehr!
Sklaven waren wir, Verräter
an dem Geiste unsrer Väter,
die im Grab nicht Ruhe fanden,
seit die Freiheit ging zuschanden.
Schwören wir beim Gott der Ahnen:
Nimmermehr
beugen wir uns den Tyrannen!
Nimmermehr!
Fluch dem Wicht, der jetzt versagte,
feige nicht zu kämpfen wagte,
dem sein Leben teurer wäre
als des Vaterlandes Ehre!
Schwören wir beim Gott der Ahnen:
Nimmermehr
beugen wir uns den Tyrannen!
Nimmermehr!
Statt die Ketten zu zerschlagen,
haben wir sie stumm ertragen.
Rühmlicher und ehrenwerter
sind für Männerhände Schwerter!
Schwören wir beim Gott der Ahnen:
Nimmermehr
beugen wir uns den Tyrannen!
Nimmermehr!
Waschen wir mit Blut die Schande
weg von unsrem Vaterlande,
daß sein Schild in allen Breiten
strahle wie zu alten Zeiten!
Schwören wir beim Gott der Ahnen:
Nimmermehr
beugen wir uns den Tyrannen!
Nimmermehr!
Unsre Kinder sollen später
an den Gräbern ihrer Väter
stets in dankbarem Gedenken
ehrfurchtsvoll die Häupter senken!
Schwören wir beim Gott der Ahnen:
Nimmermehr
beugen wir uns den Tyrannen!
Nimmermehr!
Revolution
Mag der Feigling erbleichen, erdröhn ihm zum Hohn
wie der Donner mein Lied von der Revolution!
Fluch der finsteren Zeit, da der Tag ward zur Nacht,
die die Väter des Volks zu Verrätern gemacht!
Hast du dafür, mein Volk, deine Fesseln gesprengt,
daß noch schwerere man an die Hände dir hängt?
Noch entstellt war dein Antlitz von früherem Staub,
und von neuem schon fällst du der Willkür zum Raub.
Nicht das Schicksal erdrückt dich, versklavt wirst du heut
durch den Willen der eigenen Väter erneut.
Doch so schändlich und feig sie verletzt ihre Pflicht,
um so härter die Rache, des Himmels Gericht!
Sollst du beugen, mein Vaterland, ewig dein Haupt,
nur beworfen mit Schmutz, statt mit Lorbeer belaubt?
Eh Gewalt dich aufs neue ins Joch wieder spannt,
mach dir selber ein Ende mit eigener Hand!
Mag ein Leichnam in Fesseln, Tyrann, dich erfreun,
dein Triumphzug ein schweigender Leichenzug sein!
Auf des Vaterlands Grabhügeln prange dein Thron,
sei der Herr über Würmer, längst wolltest du’s schon!
Aber du, Volk der Ungarn, verlierst nicht den Mut,
schon erglühn deine Wangen in grimmiger Wut.
Deine Hand greift zum Schwert schon mit zornigem Schrei,
du wirst leben, wirst kämpfen solang, bis du frei!
Komm, Geliebte, und reich mir zum Kuß deinen Mund,
reich ein Glas mir voll Wein, daß ich’s leer bis zum Grund!
Ehe schal schmeckt der Kuß und der Wein im Pokal,
hebt die Fahne zum Sturm, blast das Angriffssignal!
Mag der Feigling erbleichen, erdröhn ihm zum Hohn
wie der Donner mein Lied von der Revolution!
Ich steh im Sommer meines Mannesalters
Ich steh im Sommer meines Mannesalters,
der Frühling meiner Jugend ist vorbei.
Wie viele Blüten hat er mitgenommen,
wie viele Freuden süßer Träumerei!
Der Lerche Trillern, das im Morgengrauen
mich immer wieder weckte, es verklang.
Hätt ich auch deine Liebe jetzt verloren,
trüb wär die Welt, ich lebte nicht mehr lang.
Des Himmels Frührot ist verblaßt, verflogen,
der muntre Vogel singt nun nimmermehr,
nur ein erboster Wind heult in den Lüften,
pfeift durch des Sängers Nest, das öd und leer;
fort wehte er die letzten welken Blätter
der stolzen Hoffnung, die mich einst durchdrang.
Hätt ich auch deine Liebejetzt verloren,
trüb wär die Welt, ich lebte nicht mehr lang.
Der goldne Morgenstern am rosigen Himmel,
der grünen Erde Silbertau verschwand,
die rauhe Wirklichkeit hat mir verdunkelt
den Blick mit unerbittlich roher Hand.
Mir drohn gewitterschwarze Sorgenwolken,
des Sommers Schwüle lähmt und macht mich bang.
Hätt ich auch deine Liebe jetzt verloren,
trüb wär die Welt, ich lebte nicht mehr lang.
Ein unbeständiger Gebirgsbach rauschte
an mir vorbei, romantisch klang sein Lied.
Das Lied der Ruhmsucht war’s, an ihm erquickte
sich allzu gern mein dürstendes Gemüt.
Der Bach, er fließt noch heut, doch mögen andre
draus trinken! – Ich verschmäh heut diesen Trank.
Hätt ich auch deine Liebe jetzt verloren,
trüb wär die Welt, ich lebte nicht mehr lang.
Vergeß ich einmal meine eignen Nöte
und denk ich nur an meines Landes Not,
dann seh ich vor mir eine Brut von Krüppeln,
ein Volk, das blind entgegengeht dem Tod.
Was hilft mein Fluch, was hilft’s, die Faust zu ballen!
So wein ich nur, vor Zorn und Kummer krank.
Hätt ich auch deine Liebe jetzt verloren,
trüb wär die Welt, ich lebte nicht mehr lang.
Ach, liebe mich, so heiß, wie ich dich liebe,
so leidenschaftlich, unbeirrbar treu!
Laß deines Herzens Wärme mich beglücken,
so wie das Licht des Himmels, ewig neu!
Mein einziges Licht, du meiner Tage Sonne,
mein Stern zur Nacht, dem alles ich verdanki
Hätt ich auch deine Liebe jetzt verloren,
trüb wär die Welt, ich lebte nicht mehr lang!
1848
Achtzehnhundertachtundvierzig,
Stern der Völker, Morgenrot!
Endlich ist erwacht die Erde.
Tag wird’s, doch er kündet Tod,
Tod der Nacht, der langen,
jagt mit roten Wangen
in die Flucht die finstren Schatten,
droht mit düstrer Purpurglut.
Aus den Augen der Nationen
schreien Groll und Schmach nach Blut.
Scham ob dieser Nacht der Knechtschaft
fordert Rache! Zorn und Wut
opfern nun, anstatt zu beten,
ihrem Gott – Tyrannenblut!
Sie, die uns betrogen,
uns das Blut aussogen,
als wir träumten noch geduldig,
ziehn zur Rechenschaft wir heut
für das Blut, das sie uns schuldig,
das zum roten Himmel schreit.
Selbst das Meer verstummt vor Staunen,
Wälle sieht es ohne Zahl,
Barrikaden stehn wie Wogen,
Stein gewordne, überall.
Die Galeeren beben,
die so stolz noch eben,
in des Segels blutige Fetzen
steht der Steuermann gehüllt,
stiert verzweifelt vor Entsetzen
auf das grause Schreckensbild.
Krieger überall und Waffen
auf dem blutgetränkten Feld,
mir zu Füßen… eine Krone,
eine Kette, die zerschellt.
Auf den Schutt mit ihnen!
Mag der Plunder dienen
einem Altertumsmuseum!
Schreibt die Namen drauf zuvor!
Unsre Enkel sollen wissen,
wer sie trug, wer sie verlor!
Große Zeit! Das Wort erfüllt sich:
Eine Herde nur sind wir!
Einziger Glaube ist die Freiheit.
Wer sie leugnet, büßt dafür!
Umgestürzt die alten
Heiligengestalten!
Mit den Steinen baut den Tempel,
den der Himmel nur bedacht,
daß die Freiheitssonne ewig
halte am Altar die Wacht!
Ich lieb dich…
Ich lieb dich unermeßlich,
unsagbar lieb ich dich,
nicht deine zarte, schlanke
Gestalt nur liebe ich,
nicht nur die weiße Stirne,
dein glänzend schwarzes Haar,
die frischen roten Wangen,
dein dunkles Augenpaar,
nicht nur die süßen Lippen,
die kleine warme Hand,
die zärtlich ist wie keine,
die jemals zu mir fand…
Ich lieb auch deine Seele,
hochsinnig, sonder List,
dein Herz, im Fühlen tiefer
als jeder Bergsee ist.
Ich lieb dich, wenn du lächelst,
wie wenn du weinst vor Leid,
ich lieb dich in der Trauer
wie in der Fröhlichkeit.
Die Sonne deiner Tugend
lieb ich nicht nur allein,
ich lieb dich auch, wenn Fehler
verdunkeln ihren Schein.
Ich lieb dich unbeirrbar,
so innig wie ein Mann
ein Weib auf dieser Erde
in Treue lieben kann.
Du bist mein ganzes Leben,
kein Wesen auf der Welt
hat je so sehr mein Denken
beflügelt und beseelt,
je so erfüllt mein Fühlen.
Du bist, ob Nacht, ob Tag,
die Melodie, der Rhythmus
für meines Herzens Schlag.
Willst du, daß ich verzichte
auf Ruhm, mir fiel’s nicht schwer.
Doch würd ich Ruhm erwerben
für dich nur um so mehr.
Den eignen Willen werfe
ich gerne hinter mich.
Dein Wille ist der meine,
was du willst, will auch ich.
Jedweden Wunsch erfüllen
würd ich dir ohn’ Bedacht,
kein Opfer dafür scheuen,
wenn es dir Freude macht.
Wenn du Verlust erlitten,
und wär er noch so klein,
mein Schmerz darüber würde
groß wie der deine sein.
Ich lieb dich unermeßlich,
unsagbar lieb ich dich,
kein Mensch auf Erden liebte
jemals so inniglich.
Ich liebe dich unendlich,
und stürb ich daran gar!
Möcht alles dir in einem
bedeuten immerdar.
Möcht Freund dir sein, Berater,
der für dich sorgen kann,
dein Bruder sein, dein Vater,
Geliebter, Sohn und Mann.
Wie ich mich deinem Wesen
in allem anvertrau,
sei Tochter, Schwester, Mutter,
Geliebte mir und Frau.
Ich bin dir ganz verfallen,
wahnsinnig lieb ich dich,
ich wandle wie im Traume,
verzaubert hast du mich…
Frag ich mich, wem gebühren
nun Lob und Preis dafür?
Nicht ich bin deren würdig,
nein, sie gebühren dir!
Nur du, nur du, Geliebte,
bist einzig ihrer wert…
Denn diese große Liebe,
du hast sie mich gelehrt.
Hängt die Fürsten auf
Lamberg erdolcht, Latour gehenkt am Strick!
Nun, schön und gut, doch ist’s ein Meisterstück?
Gewiß, das Volk zeigt endlich, was es kann,
doch hängt’s auch noch ein paar, was wäre dann?
Es ändert nichts an der Geschichte Lauf!
Zerschlagt die Throne, hängt die Fürsten auf!
Streift man das Laub vom Baum, hat’s einen Sinn?
Nicht lange währt’s, dann ist er wieder grün!
Mäht’ man das Gras auch bis ans End der Welt,
was nützte das? Stets wuchert’s neu im Feld.
Reißt aus die Wurzeln, nehmt die Müh in Kauf!
Zerschlagt die Throne, hängt die Fürsten auf!
Habt ihr noch nicht gelernt, daß Haß, nur Haß
den Königen gebührt? Voll ist ihr Maß!
Könnt ich verteilen meinen Haß an euch,
der mir die Brust zersprengt, ich tät’s sogleich!
Wer sich zu hassen scheut, zahlt ewig drauf!
Zerschlagt die Throne, hängt die Fürsten auf!
Verderbt sind sie, ihr Herz ist kalt und leer,
schon niederträchtig von der Mutter her,
ihr Lasterleben spricht dem Volke Hohn.
Schwarz ist die Luft von ihrem Atem schon.
Noch aus dem Grab stinkt diese Pest herauf.
Zerschlagt die Throne, hängt die Fürsten auf!
Ein blutiges Schlachtfeld ist das Vaterland,
wo nur der Tod stets reiche Ernte fand.
Hier ist ein Dorf, dort eine Stadt zerstört!
Kein Ort, wo man nicht Klageschreie hört.
Wer trägt die Schuld? Hört meine Antwort drauf:
Zerschlagt die Throne, hängt die Fürsten auf!
Der Helden Opfer bliebe ungerächt,
wenn ihr die Fürstenkronen nicht zerbrecht.
Schlägt man das Untier nicht gleich gänzlich tot,
hebt’s neu die Stirn, von vorn beginnt die Not.
Umsonst wär Blut und Tod! – Drum strömt zuhauf!
Zerschlagt die Throne, hängt die Fürsten auf!
Nachsicht zu üben, edel ist’s fürwahr;
wer sie an Fürsten übt, der ist ein Narr!
Will keiner außer mir der Henker sein,
werf ich die Leier weg und wag’s allein…
Nichts andres wendet der Geschichte Lauf!
Zerschlagt die Throne, hängt die Fürsten auf!
Leben oder Tod
Von den Karpaten bis zur untern Donau
ein wilder Sturm, entsetzlich böses Schrein.
Das Haar zerzaust, die wunde Stirne blutig:
So steht der Ungar in der Not allein.
Auch wenn ich nicht als Ungar wär geboren,
ich schlösse diesem Volk mich an fürwahr,
weil es so einsam ist und so verlassen,
wie auf dem Erdenrund noch keines war.
Du, meine Nation, mein Volk, mein armes,
ist deine Schuld denn so verachtenswert,
daß Gott und Teufel gegen dich vereint sind,
daß alles dir am Stamm des Lebens zehrt?
Wer ist es, der dich anfällt wie besessen,
in toller Wut dir abhaut Zweig und Ast?
Sie sind’s gerade, die in deinem Schatten
genossen manch Jahrhundert guter Rast.
Slowaken, Raizen, Deutsche und Walachen,
warum fallt ihr uns Ungarn an so wild?
Wer schützte euch vor Türken und Tataren,
wer führte hier das Schwert, hielt hoch den Schild?
Sooft das Schicksal Reichtum uns bescherte,
stets teilten wir mit euch das Gute brav
und nahmen euch die halbe Last vom Rücken,
wenn ihr in Not wart, euch ein Unglück traf.
Und euer Dank dafür? Vom König sündhaft
zum Treubruch hinterlistig aufgehetzt,
habt ihr uns alle gierig überfallen,
wie Raben euch auf unsern Leib gesetzt.
Ja, Raben seid ihr, widerwärtge Raben,
Fleischfresser, doch der Ungar ist nicht tot,
bei Gott, noch nicht, und malt mit eurem Blute
auf seinen Himmel helles Morgenrot.
Doch sei es wie ihr wollt, wir sind gerüstet,
zum Kampf auf Leben oder Tod vereint.
Kein Friede sei auf unsrer teuren Erde,
solang die Sonne noch auf Feinde scheint.
Kein Friede sei, solang aus euren Herzen
das böse Blut nicht völlig ausgeleert.
Wollt ihr als wahre Freunde uns nicht haben,
so sollt ihr spüren unser Richterschwert.
Auf denn, ihr Ungarn, gegen diese Meute,
die nur auf Mord und Diebstahl sinnt.
Auf denn zum großen heiligen Feldzug,
bis alle Feinde ausgerottet sind.
Wer sich bewährte viele hundert Jahre,
dem nimmt auch dieses eine nicht den Mut.
Die wir mit Löwen so oft fertig wurden,
was kann anhaben uns die Läusebrut?
Europa schweigt
Europa schweigt schicksalsergeben.
Revolution – wen kümmert’s noch?
Ihr Ruf verklang, o Schmach und Schande!
Die Freiheit stöhnt wie einst im Joch…
Verlassen sehn sich die Magyaren.
Kein Volk rührt da noch eine Hand.
Die Feiglinge ziehn vor die Ketten.
Nur wir noch leisten Widerstand!
Doch sollten wir darob verzweifeln,
wär uns zu jammern drum erlaubt?
Nein! Um so stolzer, um so höher,
mein Vaterland, erheb dein Haupt!
Nur härter macht es unsre Herzen.
Schläft auch rundum die ganze Welt,
wir halten hoch die letzte Fackel,
die diese Finsternis erhellt.
Wenn diese Fackel nicht mehr lodert,
hier unten nicht mehr sichtbar wär,
könnt man im Himmel gar noch meinen,
die Erde existiert nicht mehr.
Du blickst auf uns, Göttin der Freiheit,
bewunderst deines Volkes Mut.
Wo andre sich die Tränen sparen,
verströmen wir stolz unser Blut.
Braucht’s mehr noch, um in spätren Tagen
wert deiner Segnungen zu sein?
Verriet dich unsre Zeit, wir standen
als letzte Kämpfer für dich ein!
Ich hör die Lerche wieder singen
Ich hör die Lerche wieder singen!
Ach, fast vergaß ich schon ihr Lied.
Sing, lieber kleiner Frühlingsbote,
sing und erheitre mein Gemüt!
Dein Lied besänftigt meine Seele,
die noch vom Schlachtlärm aufgewühlt,
als ob ein Bergbach mir die Wunden
mit seinem frischen Wasser kühlt.
Sing, lieber kleiner Frühlingsbote,
dein Lied erinnert mich daran,
daß der Soldat zugleich ein Dichter,
der lieben, nicht nur töten kann.
Der Freuden, welche mir die Götter
der Liebe und der Poesie
beschert und noch bescheren werden,
denk ich dank deiner Melodie.
Erinnerung und Hoffnung schlagen
wie Rosenstöcke aus im Mai
und schmücken die beglückte Seele
mit Laub und Blütenpracht aufs neu.
Und zärtlich fliegen meine Träume,
mein Engel, wiederum zu dir,
dein denk ich, der ich treu geblieben,
so wie du treu geblieben mir.
Du meiner Seele reinste Freude,
die du geschenkt von Gott mir bist,
um mir zu zeigen, daß der Himmel
schon hier bei uns auf Erden ist.
Sing, Lerche, Bote meiner Liebe,
den Frühling weckst du durch dein Lied,
grau schien mir alles, öd und trübe,
zum Leben bin ich neu erblüht.
In den Bergen
Dort, ja dort ganz weit, tief unten,
schon im blauen Dunst verschwunden
liegt die Stadt, wie wir wohl wissen,
dennoch schon im Ungewissen,
denn die Seele hat sie eben
dem Vergessen preisgegeben.
Hier, von der Natur umschlossen,
Bergeshöhn, die hochgeschossen,
selbst die Wolke, wenn sie eilet,
zwingen, daß sie hier verweilet –
lausch ich, was in Sommernächten
Sterne mir erzählen möchten.
Hab im tiefen Tal gelassen,
das die Nebel blau umfassen,
im Stadttrubel, was mir nahstand,
Vaterland und meinen Hausstand,
alles, was mein Herz beschwerte:
Sorgen, Zukunft, teure Werte,
die mich wie grausame Schatten
hart zu sein gezwungen hatten.
Keiner darf mich dafür schelten,
wenn ich jetzt – ich tu’s ja selten,
bin für euch oft eingestanden –
leben möchte frei von Banden.
Ja, ich möchte hier nur rasten,
ohne Sorgen, ohne Lasten.
Nur die zwei, die mir so teuer,
meine Frau und meine Leier
sind bei mir. Die Liebste glücklich,
Weib und Kind in einem, pflückt sich
Blumen, kann hier tanzen, singen,
nachlaufen den Schmetterlingen,
Sträuße binden, Kränze winden,
bald auftauchen, bald verschwinden
wie die Elfe dieser Auen:
Traumschön, sie zu hörn, zu schauen.
O Natur, ich steh benommen
vor den, die du schenkst, den Wonnen.
Sprechen mit den Augen möcht ich
ein Gebet zu dir andächtig.
Herzen sind’s, die mir zustreben,
alle Blätter, die da beben,
und ich lausche, lausche lüstern
dem Geheimnis, das sie flüstern.
Zweige ragen mir entgegen,
spendend väterlichen Segen,
mir, dem Sohn, dem kindlich treuen,
der sich dankbar kann erfreuen
über einen Tag wie diesen,
dem vor Glück die Tränen fließen.
Zeit des Entsetzens
Zeit des Entsetzens, Schreckenszeit!
Geht das so fort in Ewigkeit?
Will Gott fürwahr,
daß der Magyar
wird ganz und gar vernichtet?
Aus allen Gliedern bluten wir,
die Macht der halben Erde schier
ist gegen uns gerichtet.
Vor uns der Feind – im Rücken droht
ein noch viel schrecklicherer Tod!
Die grause Pest
gibt uns den Rest!
Von Gottes Schicksalsschlägen
traf dich zuviel, mein Vaterland,
noch nie so reiche Ernte fand
Verwesung allerwegen.
Wenn wir bis auf den letzten Mann
zugrunde gehn, wer könnte dann
das grimme Leid
so schwarzer Zeit
der Nachwelt noch berichten?
Wenn aber einer übrigbleibt,
dann nennt man, was er drüber schreibt,
erfundene Geschichten.
So wahr auch ist, was er erzählt,
wie man zu Tode uns gequält,
als Märchen gält
es aller Welt
und fänd nur taube Ohren,
man hörte ihn gewiß nicht an
und dächte nur: Der arme Mann
hat den Verstand verloren.
1. Aus Handbuch der ungarischen Literaaer. Herausg. Tibor Klaniczay. Corvina Kiadó, 1977
2. Nebenfluß der Theiß